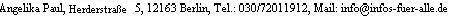Eine Berlin-Erinnerung
Juli 2002, neu bearbeitet am 4.5.2003
Zuletzt bearbeitet am 23.12.2003
Ich bin Vertreterin für bunte Schächtelchen. (Vertreter: Das sind die gut gekleideten Leute, die den ganzen Tag über gemütlich spazieren gehen und sich ab und zu mal mit Kunden freundlich unterhalten). Mit meinen langen, kastanienbraunen Haaren, die in der Sonne rot und blond wie Feuer flammen, sehe ich aus wie Schneewittchen. Ich muß mich korrigieren: ich sehe f a s t aus wie Schneewittchen. Dazu braucht man ein bißchen Phantasie. Ich trage - anders als das Märchenwesen - eine Brille und bin auch nicht ganz so zierlich. Aber groß. Unzählige Sommersprossen zieren mein blasses Gesicht wie Millionen kleiner Sonnen.
Ich arbeitete bisher in zwei Berliner Bezirken. Heute fahre ich jedoch in einen, den mir die Firma neu zugeteilt hat. Ein Drama; denn ich habe Ortskenntnisse wie ein Hamster, den man vor die Tür setzt. Mit Ware, wie in meinem alten, vertrauten Umfeld ausgerüstet, tütenfertig gepackte bunte Schächtelchen, fahre ich los.
Was erwartet mich? Wird es wirklich so schlimm, wie meine lieben Kollegen, die sich in dem neugebackenen Gebiet auskennen, unkten?
"Die neuen Kunden sind anders als in deinem alten Gebiet. Die nehmen nichts aus der grünen Palette. Und dies nicht. Und das nicht!" - "Paß auf! Die machen alle Termine!" Und: "Du hast lange Wartezeiten."
Horrorvorstellungen. Da sind also Umsatz und Pensum nicht zu schaffen, was die Firma erwartet.
Ich bin ein bißchen nervös und versuche, mich zu beruhigen: "Papperlapapp! Abwarten und Tee trinken. Übertreiben die Kollegen nicht ein bißchen?"
Ich nähere mich meinem neuen Gebiet. Zähfließender, lauter Verkehr. Stop and go. Peu à peu schiebt sich die Schlange vorwärts. Halt! Eine rote Ampel. Alle stoppen; eine Bremse quietscht. Aber es folgt kein Knall. Uff! Nochmal gut gegangen. Der Hintermann küßt fast meine Stoßstange. Die Gegend ist nicht wiederzuerkennen. Vor ein paar Jahren verzauberten noch Felder leuchtend rot blühenden Klatschmohns den Blick. Eine prachtvoll blühende Landschaft, die mir Stielaugen anhexte. Fuchs und Hase sagten sich hier "gute Nacht". Jetzt fällt mein Blick auf beeindruckende
1 Türme, einer davon in elegantem Klinkerrot. Und viele Menschen flanieren hier. Ihre Unterhaltungen, die in ein babylonisches Stimmengewirr münden, klingen wie zufriedenes Gemurmel. Leckere Düfte internationaler Spezialitäten schweben durch die Luft.
Mich beschleichen Erinnerungen ganz anderer Art. Diese Erinnerungen lassen das friedlich-freundliche Geschehen vor meinen Augen verschwimmen. Sie sind stärker als alles Jetzige zusammen. Sie kommen herauf. Ich reibe mir die Guggels. Kann das wirklich sein? Sehe ich, oder träume ich?
Ich muß doch jetzt in die Grenzanlagen einfahren, im Zick-Zack-Kurs; denn anderes lassen die Schikanen nicht zu, wenn ich in das kommunistische Paradies einreisen möchte. Dorthin, wo es keine Kriminalität gibt - jedenfalls offiziell nicht. Solche Delikte wurden planvoll unter den Tisch gekehrt, sodaß sie für die breite Öffentlichkeit unsichtbar blieb. Der Sozialismus war eine absolut saubere Angelegenheit. (Diese Auffassung verklickerte mir meine Lieblingscousine Edelgard.) In dieses Paradies will ich jetzt rein und bin an der Grenze. Das heißt, an den Grenzanlagen. Erhellt sind sie - auch am hellichten Tage - von eiskaltem, weißem Flutlicht, die meterdicken Schikanen aus Beton, die verhindern, daß Fluchtwillige sie durchbrechen und verbotenerweise in den Goldenen Westen entschwinden könnten, die Grenzhäuschen und die mit West-Autos (hier ausschließlich von West-Berlinern) gefüllten Fahrstreifen, - ja, dieses gespenstige Licht, das einen selbst im glutheißen Hochsommer frösteln läßt. Und dann halte ich vor einer Schranke.
"Den Ausweis, bitte!" verlangt ein uniformierter Mann in höflich-strengem, sächselndem Tonfall. Überall woanders, nur nicht hier an der Grenze, könnte mir der junge Mann gefallen. Aber nach Flirten ist mir an diesem, mir unheimlichen Ort nicht zumute. Ich mache ihm keine schönen Augen. Ich gebe ihm meinen Ausweis. Ich bin mucksmäuschenstill und versuche, ernst und gelassen dreinzublicken. Die Grenzpassage ist kein Zuckerschlecken. Strahle ich Angst aus?
"Haben Sie was zu verzollen?" Der junge Mann läßt mich nicht aus den Augen.
"Filzt er mich jetzt?" schießt es mir durch den Kopf. Ich versuche, wie die Unschuld vom Lande zu gucken, meine Spannung nicht zu zeigen und schüttle den Kopf. Ich habe nur Kaffee, Kakao, Rosinen, Mandeln, Ananas in Dosen, Zigaretten, Mandarinen, Bananen, Apfelsinen, Gewürze und andere Leckereien in kleinen-größeren, aber erlaubten Mengen mit. Meine Tante Lola, die eigentlich Elfriede heißt, aber so lange ich denken kann, Tante Lola genannt wird, ein mütterlicher Typ, und Cousinen Edelgard und Bibi, die ein Jahr älter als ich sind, haben sie sich sehnlichst gewünscht.
Aber - bitteschön! - nicht etwas, was man günstig kriegen könnte, nein, nicht irgendetwas, sondern bestimmte Marken, die meine Ostverwandten aus den Werbesendungen des Westfernsehens kannten. Bitte, nur das! Bitte nur Lux-Seife, die duftet so gut! Bitte nur Sarotti-Schokolade, die mit dem Mohr! Bitte nur Levis-Jeans, keine andere sieht so edel aus. Sie wußten über Westmarkenartikel besser Bescheid als ich. Bitte!!! Es gab kein Abhollager zur Versorgung der Ostverwandten. Geschenkt bekam ich nichts. Für die Einkäufe, um die immerwährende Wunschliste plus Sonderwünsche wie beispielsweise Autozusatzscheinwerfer oder Fahrradschläuche oder Rauhfasertapete plus weißer Farbe meiner Ostverwandten zu erfüllen, zweigte ich zehn bis fünfzig Prozent meines Einkommens ab (zum Glück nicht jeden Monat; sonst hätte ich nicht genügend Geld zum Leben gehabt). Ein Blumenstrauß stiftete Extrafreude; denn Blumen ergatterte man nur schwer im Osten. Und weil ich heute Geburtstag habe und meine Verwandten Pizza kennenlernen wollen, die sie nur aus dem Westfernsehen kannten, habe ich die Zutaten mit, also Tomatenmark, Maiskörner, Champignons und Thunfisch in der Büchse, Tomaten und sogar jungen Gouda und Salami sowie die Gewürze Majoran, Thymian, Basilikum und Oregano. Und - nicht zu vergessen! - auch noch Oliven und Olivenöl sowie frische Pepperoni (schön scharf, damit beim Essen die Tränen in die Augen schießen). Mehl, Hefe, Salz und Zwiebeln stellt Tante Lola. Wir backen dann zusammen Pizza. Fertige vom Italiener sollte ich nicht mitbringen; wir wollten selbst das Backvergnügen auskosten. Der Teig brodelt und blubbert im heißen Ofen, und ein verführerischer Duft zieht durch die Räume. Wir schnuppern den Duft (bei dem Gedanken daran läuft mir wieder das Wasser im Mund zusammen), der wie Glockenläuten uns zusammenruft. An den Tisch! Pizza ist fertig! Wir schwelgen dann in dem leckeren Teiggebäck. Es gibt ein Blech mit Salami- und eins mit Thunfisch-Pizza, und wir könnenen uns wie im Schlaraffenland dick und rund futtern.
Im Westen gab es einfach alles; man mußte nur im Laden mit dem Finger schnippen, und schon hatte man es. So dachten meine lieben Verwandten im Osten, die allerdings nicht verstehen konnten, wie derselbe Menschenschlag - alles fleißige Michels - so unterschiedliche Wirtschaftleistungen und Lebensstandards von demselben Nullpunkt aus nach dem Krieg und in demselben Zeitraum aufbauen konnten. Warum sie im Osten soviel schlechter dastanden als die Familie, die das Schicksal in den Westen verbannt hat. Eine Frage, über die ich nicht weiter nachdachte. Uns ging es gut; wir hatten unser Wirtschaftswunder mit Ludwig Erhard. Ich hatte andere Sorgen, interessierte mich nicht für die Ausbeutung im Sowjetsektor einerseits und die wirtschaftliche Förderung durch die Amerikaner andererseits, sondern meine Sorgen waren ganz praktischer Natur, nämlich beispielsweise: Wie erfülle ich die Wünsche meiner Verwandten? Manchmal hatten sie ziemlich knifflige Wünsche, und ich mußte mir die Hacken ablaufen, um beispielsweise Wünsche wie Stoffe ganz bestimmter Qualität und mit genau vorgeschriebenen Mustern zu erfüllen. Die Füße wund gelaufen - "Uff!" - habe ich mir auch mal, als ich eine Badekappe im Winter kaufen sollte. Mit meinem Anliegen stieß ich überall, wo ich es vortrug, auf Unverständnis und Schulterzucken. "Eine Badekappe? Im Winter?" wiederholten die Verkäuferinnen unisono ungläubig. "Das ist ein Sommerartikel. Den haben wir eingemottet." Ich gab mich damit nicht zufrieden, sondern lief weiter von Pontius zu Pilatus. Schließlich war es doch Pflicht, im Hallenbad, das im Winter geöffnet ist, eine Badekappe zu tragen. "Also," schloß ich daraus messerscharf, "muß es doch eine zu kaufen geben." Das konnte doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich diese gottvermaledeite Badekappe nicht bekommen konnte. Damals war das ein Riesenproblem und kaum zu lösen. Ich weiß nicht mehr, ob es mir dank meiner Hartnäckigkeit und Ausdauer letzten Endes doch noch gelungen war, das schier Unmögliche möglich zu machen, und die Aktion von Erfolg gekrönt war, oder ob ich doch irgendwann die Faxen dicke hatte und meine Verwandten zu meinem Bedauern auf den nächsten Sommer vertrösten mußte. Vielleicht konnte ich aber doch diese gewünschte Badekappe mitbringen und wurde ihrer Vorstellung gerecht, daß es im Westen nichts gab, was es nicht zu kaufen gab.
Was ich aber auf gar keinen Fall mithatte, waren Medien oder Tonträger irgendwelcher Art. Von West-Zeitungen, Musikkassetten und Schallplatten (noch nicht einmal mit klassischer Musik, z.B. Mozart oder Beethoven, geschweige denn die von DDR-Bonzen verpönte und als dekadent und konterrevolutionär eingestufte Pop-Musik) und solchen unerlaubten Dingen habe ich mein Auto gründlichst gesäubert. Noch nicht einmal meine Kleine durfte ihre geliebten "TKKG"-Kassetten oder "Die drei Fragezeichen" hören. Die Kinderhörspiele waren ein absolutes Tabu und eine bittere Pille für Tamila. (Ab und zu schenkte mir Edelgard eine Platte, die sie durch Beziehungen erhalten hat. Die gab es sozusagen nur unterm Ladentisch. - Ausführen durfte ich DDR-Schallplatten). Meinen mitgeführten Geldbetrag in DM hatte ich gewissenhaft deklariert. Ich schmuggelte nichts.
Die Rechenmaschine hatte mein Cousin Manuel, der Bruder der Zwillingsschwestern Edelgard und Bibi, schon längst; die hätte der Zoll beschlagnahmt, wenn er sie gefunden hätte. Den Stadtplan von Berlin hatte mir Krauskopf Manuel auch schon abgenommen. Er wollte gern wissen, wo ich in West-Berlin wohne. Auf dem DDR-Stadtplan von Berlin war der gesamte Westteil ausschließlich eine einzige weiße Fläche. Keine Straßen, keine Parks, kein Nichts, nur weiß, als ob es West-Berlin mit seinen damaligen 2,3 Millionen Einwohnern nicht gäbe.
Die Diplomarbeit einer Flüchtlingsfrau war schon im Westen, bevor meine Tochter Tamila zur Welt kam. Die Tochter von einer DDR-Bekannten meiner Mutter, die gerade ihr Studium beendet hatte, war mit der Eisenbahn ins "sozialistische Bruderland" Tschechoslowakei gereist, um dort in der Toilette der Eisenbahn für neun oder achtzehn Stunden (ich weiß es nicht mehr ganz genau) zu verschwinden. Jede Menge Kohlenstaub hatte sie im Gepäck, mit dem sie sich und ihre Freundin schwärzte, um im Hohlraum unter dem Zugdach bei Kontrollen nicht gesehen zu werden. Sie wäre beinahe zu früh ausgestiegen; in Ungarn. Und hatte sich verraten. Aber der Grenzer drückte beide Augen zu und ließ sich mit Geldscheinen bestechen und verpfiff sie nicht. In Österreich war dann die Reise in den goldenen Westen zu Ende.
Die junge Frau kam nach Berlin, ins Notaufnahmelager Marienfelde. Von dort zog sie um nach München. Nach dorthin trug ich ihr ihre Diplomarbeit hinterher; denn im Notaufnahmelager Marienfelde konnte ich sie nicht erreichen. Ich wurde nicht reingelassen. Ich durfte nur eine Nachricht hinterlassen, ohne daß mir gesagt wurde, ob sie noch da ist oder jemals dort war. Den Namen von der jungen Frau habe ich damals noch gewußt. Aber ich kannte sie nicht und habe sie nie kennengelernt, obwohl ich Bautzen, das Gefängnis als Vorhof zur Hölle, für sie riskiert hatte. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist; sie hat sich noch nicht einmal bedankt. Undank ist der Welten Lohn.
Ich hatte nie eínen gefälschten Ausweis in der Vagina versteckt, um einen Menschen aus der DDR herauszuschmuggeln. Das war mir viel zu gefährlich. Ich konnte es mir nicht leisten, mich mit einer mehrjährigen, drohenden Haftstrafe zu gefährden, wenn ich erwischt wurde; ich hatte ein Kind zu versorgen. Mein Ein und Alles. Im Fond saß mein sechsjähriges Töchterchen, das ich abgöttisch liebte und das mich brauchte. Der hatte ich eingeschärft, keinen Mucks von sich zu geben, damit wir nicht in Teufels Küche geraten. Wer weiß schon, was ein kleines Kind äußert und wie es aufgefaßt wird? Ein falsch verstandenes Wort kann fatale Folgen haben. Um Plappermäuler zum Schweigen zu bringen, war die Grenzpassage wirksamer als jedes Pflaster auf den Mund. Die Kleine, die gerade lesen lernte, saß nun ganz brav da, ihr niedliches Schmusehündchen Kracksi fest an sich gedrückt, und schaute stillschweigend und mit großen, unschuldigen, aufmerksamen Augen. Ihre Fingerchen streichelten liebevoll über die rehbraune Stoffhundeknubbelnase.
"Führen Sie Waffen oder Munition mit sich?" durchschneidet die Stimme meine unterdrückte Nervosität. Waffen? Munition? Was für Fragen! Im Geiste höre ich einen furchtbaren, todbringenden Knall. Ich könnte keiner Fliege was zuleide tun. Sehe ich verdächtig aus? Oder mein Auto? Verhalte ich mich verdächtig?? Waffenbesitz ist in ganz Berlin verboten. Sowohl im Westen als auch im Osten. Alliiertengesetz, also Beschluß sowohl der Amerikaner, Engländer und Franzosen einerseits als auch der Russen andererseits, die die Stadt unter sich in Sektoren aufgeteilt hatten. Und außerdem - was soll ich mit Pistolen, Gewehren oder sonst so etwas Gemeingfährlichem? Ich bin doch ein braver Spießbürger.
"Nein," presse ich mit bemüht ruhig klingender Stimme heraus.
"Steigen Sie bitte aus!" fordert mich der gutaussehende, schlanke, junge Uniformierte auf. Ich komme nicht auf die Idee, daß ihn meine Figur interessieren könnte. Vielmehr überfallen mich Gedanken wie: "Muß ich auch die Sitzbank hochklappen?" Nein, heute nicht. Das Kind darf sitzenbleiben. Der Grenzer und ich sprechen dieselbe Sprache. Aber zwischen unserer Sozialisation liegen Welten. Er: Ost-, ich: West-Erziehung und -kultur. Ich folge seinem Befehl und verlasse meinen himmelblauen VW-Käfer.
Auch ein Mann mit graumelierten Schläfen in der Nebenspur quält sich aus seinem chicken, silbermetallic glänzenden Jaguar. Er wird von einer kugelrunden, kleinen Frau abgefertigt. Er, der eine viel gehobenere, gesellschaftliche Stellung inne zu haben hat als ich, wird in derselben Manier abgefertigt wie ich. Soziale Unterschiede spielten hier an diesem Ort keine Rolle. Hier herrschte sozialistische Gleichheit. (Die Frauen, die hier bei den Grenzkontrollen arbeiten, hatten den zweifelhaften Ruf - ja, sie waren geradezu verschrien, Drachen zu sein und besonders scharf zu kontrollieren und ihre Geschlechtsgenossinnen aus dem Westen besonders gemein zu schikanieren. Da kann ich von Glück reden, daß ich an diesen hübschen, jungen Typ geraten bin und nicht an eine Gewitterhexe.)
In der anderen Nachbarspur erkenne ich das Ehepaar wieder, das beim Warten zur Einfahrt in die Grenzanlagen neben mir stand und miteinander flirtete wie Turteltauben. Jetzt steht es neben seinem Auto. Kofferraum und Motorhaube sind geöffnet. Von Erotik sind die beiden hier völlig entblättert. Jeder der beiden guckt nun finster verschlossen vor sich hin. Nur ab und zu werfen sie sich einen verstohlenen, verzweifelten Blick zu. In ihrem Auto sitzen auf der Rückbank zwei Jungen und ein Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren steif und stumm wie zu Salzsäulen erstarrt. Vorhin haben sie sich noch munter gebalgt.
"Öffnen Sie bitte den Kofferraum. Und die Motorhaube!" Schikaniert er mich nun? Läßt er mich rechts heranfahren? Um unter die Sitze und die Fußmatten zu lugen? Nimmt er mein Vehikel auseinander? Ich bin ein einziger Angstbolzen. Hier bin ich nicht im Safaripark, wo die Leute Riesenvielspaß haben, wenn die Affen die Antennen abknicken und die Gummiteile am Auto abfressen - und ich hinterher sehen kann, wie ich mit dem Schaden fertig werde. Hier ist es auch kein bißchen komisch, schon gar nicht wie bei den lustigen Affen, die auf den Autos herumturnen wie auf einem Klettergerüst. Hier herrscht Riesenvielangst. Wird der Gestrenge mir helfen, den Wagen wieder zusammenzubauen? Muß ich aussteigen, um die prallvollen Taschen mit kleinen Geschenken in einen unwirtlichen, merkwürdig stinkenden Raum zu schleppen, wo ich sie bis auf das letzte Taschentuch auspacken muß? Oder muß ich mich gar einer entwürdigenden Leibesvisitation unterziehen? Wieviel endlos quälend-lange Stunden muß ich warten? Ich fühle mich wie ein zappelnder Fisch an der Angel, der sich in seine todbringende Situation fügen muß.
"Warum setze ich mich nur immer wieder diesem Trauma aus?" frage ich mich. Diesem einzigartigen Angsterlebnis, hervorgerufen durch die gespenstige Anlage und der über uns wie ein drohendes Damoklesschwert hängenden Willkür und Schikane. Nur die Liebe kann das sein, die Liebe zu meinen Verwandten, die keine Möglichkeit haben, uns zu besuchen. - Ich bin kein Bösewicht. Ich habe nichts zu verstecken. Ich bin nur ein West-Berliner, der die Schwester meines Vaters mit ihren Zwillingstöchtern in Ost-Berlin besuchen will. Aber ich fühle mich wie ein erwischter Schwerverbrecher. Das kann ich dem gestrengen Grenzer jedoch nicht sagen. Dann bin ich gleich für Schikanen fällig. Befremdliche Situation. Ich bin ihm so hilflos ausgeliefert...
Der ältere Jaguar-Fahrer sackt plötzlich zusammen und fällt um. Auf der Straße bleibt der Mann regungslos liegen. Mir bleibt fast das Herz stehen. Niemand rührt sich. Alle Anwesenden scheinen an Händen und Füßen gefesselt zu sein und einen zugeklebten Mund zu haben. Alle warten schweigend ab, was passiert. In dem bleiernen Licht wirkt das wie eine unwirkliche Szene in einem Film. Zunächst passiert nichts. Vielleicht sind nur ein paar Minuten vergangen. Ganz bestimmt sind nur ein paar Minuten vergangen. Aber mir erscheint die Zeit wie Ewigkeiten, bis ein Gerenne einsetzt, ein Arzt gemessenen Schritts herbeieilt, den Zusammengebrochenen untersucht und Reanimationsversuche einzuleiten scheint. Herzinfarkt? Das werde ich nie erfahren. Der Kranke wird abtransportiert (ins Krankenhaus?, auf den Friedhof? - Fragen, die offen bleiben müssen) und ich weiter abgefertigt. Was wird aus dem Auto? Auch das werde ich nie erfahren.
Meine Nachbarin zuhause, Frau Ritter, eine klapperdürre Rentnerin, die aussah, als ob sie nicht genug zu essen hätte, und so ärmlich gekleidet war, daß man geneigt war, ihr einen Mantel oder ein Paar Schuhe zu schenken, besuchte immer wieder ihren einzigen Verwandten in der Deutschen Demokratischen Republik, einen Neffen. Die Rentnerin stand normalerweise den ganzen Tag am Fenster und beobachtete meine Garage. Ich bekam oft Lieferungen von der Firma, und immer dann, wenn ich unterwegs war, und sie paßte auf. Dort war das Tor nie abgeschlossen, und Frau Ritter achtete darauf, daß alle Lieferanten nur etwas reinstellten und nichts rausholten. Das klappte prima.
Diese arme Frau jammerte und klagte herzzerreißend über die vielen Wünsche ihres Ostverwandten. Deren Erfüllung schien sie sich vom Mund abzusparen. Eines Tages im Wonnemonat Mai, als die Bäume ausschlugen und die Natur sich verjüngte und grünte und sproß nach dem langen Winter, fuhr sie mal wieder mit der Eisenbahn zu ihrem Neffen, bepackt wie ein Weihnachtsmann. Sie kam nie an und nie mehr zurück. Auf dem Ostbahnhof in Ost-Berlin mußte sie umsteigen. Sie wartete auf dem Bahnsteig auf den Zug - und fiel tot um. Herzschlag. Die Aufregung de Grenzübertritts war zuviel gewesen. -- Zuhause bei ihr fand dann der Nachlaßverwalter des Neffen zweiundvierzig funkelnagelneue Pelzmäntel und Hunderte Schuhpaare, die die Frau niemals getragen hatte, sondern immer nur die, die abgelaufen waren und von denen die Sohlen abklappten. Dazu erbte der Neffe von seiner "armen" Tante eine halbe Million D-Mark, eine wahrhaft fürstliche Summe. Mit derartig viel Geld konnte man sich hier im Westen im Nobelviertel Dahlem ein Haus kaufen. Das Geld hatte meine Nachbarin, die im zweiten Weltkrieg schreckliche elf Tage unter ihrem Wohnhaus verschüttet worden war und diese mißliche Lage überlebt hatte, - man kann es kaum glauben - diesen Batzen Geld bewahrte meine Nachbarin im Sparstrumpf unter der Matratze auf.
Gespenstisch ziehen diese teuflischen Erinnerungen vor mir auf. KEINE Fata Morgana. Hier bin ich nicht in der Wüste, auch wenn dieser Ort so öde und trostlos aussieht.
"Steigen Sie bitte wieder ein!" spricht der Grenzer die erlösenden Worte. "Angenehmen Aufenthalt!" wünscht er noch. Befreit! Nichts Gefährliches passiert. Drei Kreuze! Heute. Kaum daß wir die Grenzanlagen hinter uns gelassen hatten, fiel die Spannung, die fast die Nerven zerriß, schlagartig von mir ab. Als hätten wir eine Zwangsjacke abgelegt, kam wieder Leben ins Auto. Tamila alberte mit ihrem Hundeli Kracksi, und ich lachte und scherzte mit ihr. Hahaha - tralala. Aus dem Autoradio, das ich während der Grenzpassage abgestellt hatte, ertönte das Liedchen: " Alle Engel lachen..." Ich summe es mit, und meine Kleine kräht ungeniert dazwischen. Schmetternd stimmte ich mit ein, als "Bolle reiste jüngst zu Pfingsten, nach Pankow war sein Ziel..." gespielt wurde. Wir wollten nicht nach Pankow, sondern nach Friedrichshagen, einem Ortsteil hinter Köpenick. Ich stelle den Sender auf englischsprachige, laut bummernde Popmusik um, zu der ich den Takt aufs Lenkrad klopfe und Tamila an die Scheibe trommelt. Laut und falsch trällern wir mit. Vielleicht klingt es wie Katzenjammer, aber uns macht es Spaß.
Schnurstracks fahren wir nun zu meinen Verwandten, in eine Welt, wo die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stehen geblieben zu sein scheint. Die Häuser blicken recht runtergekommen drein. Einschußlöcher zieren viele Fassaden, das Pathos des Krieges spiegelt sich hier wider. Dabei ist dieser Staat DDR wohl das reichste Land des Ostblocks. Über die Dahme rauschen wir drüberweg, an dem Köpenicker Schloß mit der Meißner Porzellansammlung vorbei. Hier sorgte mal der Hauptmann von Köpenick für Furore, der die Obrigkeit an der Nase herumführte. Außer dem Hauptmann von Köpenick gibt es hier nur stinknormale Normalos, kein einziger Hippie, kein einziger Punk, kein weiß-ich-wie auffallender Mensch und auch keine Ausländer. Die Russen, die es hier geben muß, sind in Kasernen weggesperrt. Auch Vietnamesen, die hier ganz bestimmt leben, sind unsichtbar. Die DDR-Regierung pflegte freundschaftliche Beziehungen zum nordvietnamesischen Präsidenten Ho Chi Minh, der ihr beispielsweise 1966 ein Nordvietnam-Wrackteil schenkte, ein Kunstwerk aus Stahl, Holz und Glas, 22 x 16,5 x 10 Zentimeter groß. Noch so ein geteiltes Land. Wir aus dem Westen pflegten zu Süd-Vietnam zusammen mit der befreundeten Schutzmacht Amerika freundschaftliche Beziehungen. Wir holpern hoppel-hopp über das Holperpflaster, wo uns fast das Gehirn aus dem Kopf fällt und keinen Platz mehr für eigene Gedanken läßt. Aber das tut unserer guten Stimmung keinen Abbruch, auch wenn die Stimme sich beim Liedchenträllern sich jetzt anhört, als ob wir die Hand immer wieder vor den Mund halten und wegnehmen wie man Indianergeheul imitiert. Manchmal überschlagen sich auch unsere Stimmen, und wir schnappen nach Luft, um dann wie die blauschwarzschillernden Raben zu krächzen. Manchmal bleibt mir auch einfach der Mund offen stehen und klappt erst nach einer Weile wieder zu, wenn ich die vielen Plakate gelesen habe, die unsere Fahrt durch Ost-Berlin pflastern. Z.B. springen mir Sprüche entgegen wie Den Plan erfüllen und übererfüllen oder Junkerland in Bauernhand oder Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen! oder Überholen, ohne einzuholen. Derweil fahren wir an stinkenden, knatternden Trabbis vorbei oder strömen mit ihnen im fließenden Verkehr. Ich versuche, uns vor diesen Stinkbomben zu schützen und stelle die Lüftung ab. Die meisten dieser kleinen Töff-Töff-Autos waren mit vier Personen besetzt. "Die Menschen müssen bestimmt darin die Beine anziehen," dachte ich. Für meine Begriffe saßen sie wie Affen auf dem Schleifstein. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß sie bequem sitzen, sondern eher so wie im italienischen FIAT 500, der nahezu aus dem Straßenbild verschwunden ist. Ich halte mich strikt an die Verkehrsregeln und natürlich auch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen; denn Westlern drohten drakonische Strafen und Barzahlungen (natürlich nicht in dem durch Tauschzwang erworbenen Ostgeld, sondern in harter DM). Die einheimischen Fahrer verhielten sich lockerer und düsten an mir vorbei. "Die Trabbifahrer haben ihren inneren Parteitag, wenn sie dich überholen können." Das äußerte regelmäßig meine Cousine Edelgard, wenn sie mit mir mitfuhr und ich mich überholen ließ. Und auf meinen fragenden Blick erklärte sie schlicht: " Sie freuen sich, wenn sie an dir vorbeiziehen kjönnen." Es gab öfter mal Schlaglöcher, die so tief waren, daß nach einem Regenschauer ein Hund darin ertrinken würde. Für die Trabbi-Besitzer waren sie der reinste Horror; denn gingen die Autos kaputt, gab es keine (oder nur sehr schwer) Ersatzteile. Allen Schlaglöchern - Vorsicht! -, die es im Westen nicht gab (damals noch nicht gab, und ich hätte mir nie träumen lassen, daß es mal so weit kommt, daß man dort diesen auch ausweichen muß; denn es gibt häufig statt Reparaturen nur noch Warnschilder), konnte ich unterwegs ausweichen. Drei Kreuze!
Die sonnabendmittags um zwölf Uhr verwaisten, geschlossenen Geschäfte erstaunten mich zwar, denn im umsatzorientierten Westen hatte um diese Uhrzeit noch jeder Laden geöffnet, aber ich mußte ja nichts kaufen. Im Arbeiter- und Bauernstaat DDR steht man früh auf (und hat so spät bereits seine Einkäufe erledigt), erfuhr ich später. Gut gelaunt kommen wir endlich bei Tante Lola, Edelgard und Bibo an, glücklich, die Grenze ungeschoren passiert zu haben, denn der Willkür sind keine Grenzen gesetzt. Meine Verwandten sind überglücklich, daß ich mit meinem Sack voller Geschenke heil angekommen bin. Ich fühle mich hier pudelwohl; irgendwie ist hier eine gemütlichere Atmosphäre als im Westen, streßfreier. Nicht so hektisch. Ein Relaxtag für mich.
Ein Festtag für mich. Mit Pizza-Backen und fettreichem Schlemmen mit Pilzen - die Tante Lola im volkseigenen Wald verbotenerweise gesammelt und sich damit persönlich am Volkseigentum bereichert hat - bei entspannender, klassischer Musik, die Edelgard so liebt und die ich ab und zu von ihr als Schallplatte ("von UNTERM Ladentisch") geschenkt bekam. "Butter gibt es hier reichlich," erklärt sie mir und fügt hinzu: "Butter macht satt und in diesem Staat darf niemand hungern und braucht auch niemand zu hungern." Damit spielte sie auf unsere Obdachlose an, die es im Osten nicht gab. Da wurde jeder irgendwie auf der Arbeit mit durchgeschleppt. Und jeder hatte Arbeit.
Ich kann es nicht fassen. Vergangenheit. ---
Auch der Kontakt zu den Verwandten. Mit diesem Schicksal stehe ich nicht allein da, sondern teile es mit vielen. Geteiltes Leid ist halbes Leid - oder? Nach der Grenzöffnung brauchten sie mich nicht mehr, ihnen ihr Leben angenehmer zu gestalten. Schnabbellebensmittel wie Schokolade und Kleidung - zum Beispiel die heißbegehrten Jeans und andere "edel" aussehende Klamotten wie Blusen, T-Shirts und gemusterte Perlonstrümpfe, Schminke, Tapeten und andere Mangelware konnten sie nun selbst kaufen, auch Malerfarbe und Autoteile und pipapo. Nach dem Mauerfall bekam jeder DDR-Bürger 100 DM vom Westen von Staats wegen geschenkt. Ich konnte das Einkaufengehen vergessen, so rappelvoll waren die Läden. Man konnte nicht mehr treten vor Menschen hier in Berlin, und an der Kasse stand man nicht mehr lange fünf Minuten an, sondern wenigstens eine gewaltige Stunde. Das Warenangebot reichte für alle. - Wieder ein Gedankenblitz: Das Geld, was ich zwangsweise bei Verwandtenbesuchen in der Ostzone umtauschen mußte, die 25 DM 1zu 1 in Blechgeld, Ostmark, die nur ein Viertel bis ein Fünftel nach dem offiziellen Kurs wert war, ließ ich bei meinen Verwandten. Was sollte ich dafür kaufen? Wie sollte ich es ausgeben? Es gab nichts. Und die Aus- und Einfuhr der DDR-Mark war verboten. Westgeld ließ ich ihnen auch da. Das war erlaubt. Das war die Zauberwährung, mit der man vieles bekam, was es sonst nicht zu kaufen gab. Meine Verwandten konnten damit in den Intershop gehen, besondere Läden, wo man Westwaren bekam, aber auch mit Westmark zahlen mußte. Hier bekam man die knappen, aber begehrten Genußmittel wie Kaffee und Kekse, beispielsweise die mit Schokolade gefüllten runden, die
Prinzenrolle hießen. Auch Klamotten wie Jeans und Elektroartikel wie Kassettenrecorder, die wie alle elektrischen Geräte nicht von uns Verwandtenbesuchern eingeführt werden durften. Heiß begehrt waren auch Legosteine. Hatte man als Ost-Bürger solche Sachen, die man unter Umständen gar nicht brauchte, aber ein anderer, der etwas hatte, das man selbst begehrte, dann konnte man einen Tausch oder einen Ringtausch starten. Das funktionierte so: Ich kenne den und den und der kennt den und den und der wieder jemanden anders und der nächste hatte das, was man brauchte. Und in der Reihenfolge wurde der Kontakt hergestellt. So lernte man Himmel und Menschen kennen und baute sich viele nützliche Kontakte auf. Vitamin B wie Beziehung hilft immer weiter. - Meine Verwandten konnten also kaum Geld ausgeben, jedenfalls kein Ostgeld; das wollte keiner haben. Nur die heimliche Währung, mit der man alles kaufen konnte, die starke DM, die war interessant. Und so waren sie - wie ihre Mitbürger - gezwungen, das zu tun, worauf die Menschen im Westen so scharf sind; Geld horten und es anzuhäufeln wie Dagobert Duck, um sich kleine Vermögen anzusparen. Sie erlangten damit etwas, was jeder im Westen gerne hätte: Geldvermögen, in dem man baden konnte. Darin waren sie uns meisterlich überlegen.)
Die Mauer zerschnitt die Familien, aber ihre Öffnung trennte Familien.
Die Ampel springt auf Grün. Ich schwappe wie auf einer Welle von einhundertdreiunddreißig Autos über diesen Ort. Nanu? Du reibst dir die Aaaaaugen! Freie Fahrt? Für freie Bürger? Auch für die unendlich vielen, bunten Radfahrer, die auf leisen Rädern durch die Metropole schnurren, und die großen Gelben, nicht die roten - wie in London -, sondern die gelben (ehemals West-)Berliner Doppeldeckerbusse? Oder nur eine Illusion? Die Trabbis, die zu Autos geprägten Pappen, diese Zweitakter, die mal hier das Straßenbild prägten, sind verschwunden. Heute mal einen im Verkehr zu sehen, ist eine Sensation. Mein VW-Käfer von damals hat sich in einen Volvo-Kombi verwandelt. Dieses skandinavische Schlachtschiff, mit dem ich durch den Verkehr segle. Der Käfer wäre heutzutage auch schon ein Museumsstück.
Ich komme in meinem neuen Gebiet an. Hier fahren auch Straßenbahnen, etwas für mich völlig Ungewöhnliches. Es gibt allerdings auch Schienen, die im Irgendwo anfangen und im Nirgendwo aufhören
**.
Sie führen genau über eine Straßenkreuzung, und die Trasse ist keine fünfhundert Meter lang. Neu gebaut und ohne Anschluß. Ein Husarenstück. Oder ein Stück aus dem Tollhaus? Was die (da oben) sich dabei wohl denken? Wieviel Milliarden haben die Schienen verschlungen? Oder waren es nur Millionen? Oder gar bloß Tausende? "Verflixt und zugenäht! Dieser Schildbürgerstreich," fluche ich. Wenn die Schildbürger nicht vor Neid erblaßt wären, weil sie nicht selbst auf eine solche superhirnige Idee gekommen waren, dann hätten sie sich vor Freude über diesen genialen Streich die Hände gerieben und wären sicherlich mächtig stolz gewesen, wenn sie diesen Meister der Tollheit in ihrer Mitte hätten begrüßen dürfen. Alle Ehren hätten sie ihm zukommen lassen. Hier sind wir allerdings nicht in Schilda, sondern in Berlin. Hier tragen die Gemeinderatsmitglieder eigentlich nicht das Licht in großen Säcken ins neu erbaute und mächtig repräsentative, aber fenstertlose Rathaus, nein, ganz anders. Hier lauert Gefahr. Hier gefährden diese Schlaumeier die Gesundheit ihrer steuerzahlenden Schäfchen. Ich kann zusehen, wie ich mein Auto nicht zur Straßenbahn werden lasse und gleichzeitig das Kunststück vollbringen, nicht in den Gegenverkehr zu bumsen oder meinen Nachbarn anzurumsen. Für diese Irgendwo-Nirgendwo-Schienen war Geld in Hülle und Fülle da. Ansonsten knappst Vater Staat mit dem Geld von hinten und von vorne und hält mit beiden Händen ganz fest die Taschen zu (jedenfalls, wenn es um Bildung, Kultur oder soziale Projekte geht. - Naja, Hand aufs Herz, wenn es den Schützlingen nicht zu gut geht, kommen sie wenigstens nicht auf dumme Gedanken; dann haben sie andere Sorgen, nicht wahr?).
Ich suche die erste Straße. Ja! Da vorn muß sie sein! - Aber... was soll das denn? - - - Baustelle. Umleitung. Das war nicht eingeplant. Ich stehe wie der Ochs' vorm neuen Tor. Andere Autofahrer hupen penetrant. Vielleicht aus Ärger. Ach, du grüne Neune. Ich verfahre mich total. Damit habe ich nicht gerechnet.
Wo bin ich? Tastend-suchend schaue ich mich um... Es geht einszweifix, da sperre ich Augen, Ohren und Nase sperrangelweit vor Staunen auf. Und alles Neue lasse ich zu mir herein wie ein offenes Fenster die sonnig-frische Frühlingsluft.
Was ist das denn? Ich begegne einer zimmergroßen
2
Kugel, farbig wunderbar ansprechend. Eine Kugel, an der einladend ein Stuhl und eine Leiter hängen. Wie eine duftende Wurst an der Angel vor der lüsternen Nase. Unerreichbar.
"Huch!" Erschrocken schaue ich hoch. Mir reicht ein Hüne von einem Mann seine Pranke. Unverhofft taucht sie schlankweg vor meinen Augen auf. Geräuschlos hat er sich mir genähert. "Siehste wohl, da kimmt er, Riesenschritte nimmt er..." (Den Altberliner Gassenhauer summe ich aber erst, als sich der Überraschungsschreck gelöst hat). Mein Kopf befindet sich in seiner Schritthöhe. Ach Herrje! Mich durchzuckt ein Schreck wie Blitz und Donner, und ich bleibe wie elektrisiert stehen. - Da bemerke ich meinen Irrtum. Es handelt sich um ein Standbild mitten auf dem Bürgersteig. Die majestästische, überlebensgroße Plastik ist
3
Architekt. Eigentlich nicht gefährlich. Nur ein Architekt? Nicht gefährlich? Wirklich? Vielleicht ist das so, wenn man beispielsweise an die Märchenbauten des Österreichers Friedensreich Hundertwasser und des Spaniers Antoni Gaudi und nicht an austauschbare Glasfassaden denkt. Nicht alle lieben Hundertwasser. Das Auge mag sich an seinen Bauten stoßen... an den knallbunten Farben, an dem Kitschig-Verspielten, an seiner Naturverbundenheit..., aber es prallt nicht ab wie an spiegelglatten Glasfassaden oder streng eintönig gegliederten Fassaden. Rationalität wird groß geschrieben. Ist Rationalität alles? Ist sie ausreichend zum Wohnen und Entscheiden? Das, womit sich unsere heutigen Politiker in den protzigen Neubauten oder modernisierten Altbauten umgeben. Werden sie damit menschlich beeinflußt?
Architekten können allerdings auch die Stadt verschandeln. Die Gesellschaft "Historisches Berlin", die sich für den Schloßaufbau an seiner ursprünglichen Stelle neben Erichs Lampenladen, dem Palast der Republik, der nach dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker mit der Berliner Schnauze betitelt wurde, und dem ehemaligen Staatsratsgebäude mit dem Original-Schloßtor gegenüber dem Berliner Dom einsetzt, hat einmal eine Ausstellung architektonischer Glanz(?)-leistungen gezeigt. Die Besucher konnten ihr Votum zwischen "gelungen" und "nicht gelungen" in Abstufungen abgeben. Es waren da furchtbar häßliche Neubauten bei. Das Abstimmungsergebnis habe ich leider nie erfahren. - Im Internet gab es mal eine Umfrage, welche Häuser man lieber abreißen sollte. Mit dem Geschmack ist es so eine Sache. Derjenige der Architekten und Meinungsträger unterscheidet sich aber häufig von dem der Allgemeinheit. Könnte man Architektur als besondere Geschmacksrichtung bezeichnen? Oder als Modetrend, unter dem sich Baustile herausbilden? Wie beispielsweise Romanik, Gotik, Barock, Klassizismus, Moderne? (Ich wohne in einem neobarocken Haus, das den Krieg unbeschädigt überlebt hat. Es ist schon über hundert Jahre alt).
Neugierig schaue ich mich weiter in meinem neu zugeteilten Gebiet um und werde wieder abgelenkt. Oh! Was für eine
4
Ruine! Warum zieht sie mich so magisch an? Bin ich von allen guten Geistern verlassen? Oben auf dem Dach wächst eine Birke. Und am Dachfirst noch solch ein Symbol des Lebens. Das weiße, von zartem Grün gekrönte Stämmchen hebt sich deutlich vor dem unheilverkündenden Düster der zerbrochenen Mauern ab. Einen stillen, morbiden Charme verströmt dieses unheimliche Riesengebäude.
Ganz im Gegensatz zu dem großen
5
Bahnhof, wo ich mir - inzwischen hungrig wie ein Löwe - ein Kebab zu essen hole. Die Züge spucken nicht
6
Tränen vergießende, sondern lachende Menschen aus. Menschen aller Nationen. Aller Haut- und Haarfarben. Sowohl aus der Alten als auch aus der Neuen Welt. Hier finden sich Fremde zusammen. Mich sprechen zwei adrett im Anzug gekleidete Schwarze an, denen der Hunger aus jeder Pore quillt: “Verzei'ung! Wo - gibt - es - denn - bitte - Döner?” fragten sie mich in langsamem Deutsch mit französischem Akzent, jedes Wort überlegend. Mein leckeres Fastfood genüßlich mampfend, begleite ich sie ein Stück und zeige ihnen die Bude. Dankbar lächelnd verabschiedeten sie sich und drehten mir den Rücken zu.
Ich fühle mich selbst ein bißchen wie ein Tourist in der Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin.
Ich gehe über eine Brücke. Oha! Auf ihrer Mitte bewundere ich eine überlebensgroße
7
Bronzeplastik. Ui! Guck doch mal da! Ui! Guck doch mal! Das klitzekleine Mäuslein!
Das possierliche Tierchen ist vor meiner Hand nicht sicher. Es glänzt, als hätten es schon viele Hände liebkost. Unten schimmert die sich leicht kräuselnde Wasseroberfläche, in der sich das umgebende, üppige Grün spiegelt.
Ich beiße mich durch meinen niegelnagelneuen Bezirk durch und sauge seine Herrlichkeiten wie ein trockner Wüstenboden das lebensspendende Regenwasser auf.
Bin ich noch in Berlin?
8
Kleinstadtidylle hier. Mitten in der Großstadt. Ohne brausendem Verkehr. Ohne Autos. Nervenberuhigende Stille. Nur Himmel und Menschen bevölkern vor allem die Schattenplätzchen an diesem heißen Sommernachmittag. Ein Teil von ihnen sitzt an Tischchen vor einer Gaststätte. Die Spree plätschert gemächlich vor sich hin. In ihr spiegelt sich eine grausige Szene wieder, von der die kaffee- oder Berliner Weiße mit rotem oder grünem Schuß trinkenden Restaurantgäste Zeuge werden: In dieser himmlischen Ruhe kämpft ein muskulöser Drachentöter. Gerade will er dem riesengroßen Drachen den Todesstoß versetzen, der sich wütend zähnefletschend wehrt.. -
Ungerührt und unbeeindruckt von dem blutigen Geschehen schlenderte ein Leierkastenmann vorbei. Er war in elegantem Zille-Look gekleidet, blütenweißes Hemd, kohlrabenschwarze Weste und schwarze Pluderhose. Dazu trug er eine braun-gelbkarierte Schiebermütze. Auf seinem pompösen Leierkasten saß ein rehbraunes Äffchen mit schwarzer Schiebermütze, die immer wieder über seine frechen Augen rutschte, weil sie viel zu groß war. Das lustige Kerlchen neben dem Zahlteller hielt mit unverschämter Dreistigkeit die Hand auf. Ich blieb stehen und lauschte andächtig den alten Gassenhauern, zum Beispiel "Solang' noch unter'n Linden die alten Bäume blüh'n", das er mit seiner Brummstimme anstelle von Marlene Dietrich sang. Wenn der Leierkastenmann nicht olle Berliner Kamellen dudelte, so etwas wie "Durch Berlin fließt immer noch die Spree..." und "Unter'n Linden, unter'n Linden...", ein Lied, das Walter Kollo komponiert hat, schob er dem lustigen Äffchen-Gesellen liebevoll die riesengroße Mütze aus dem Gesichtchen und die kessen Äuglein blitzten darunter wieder hervor.
Um den Leierkastenmann tanzt ein kleiner, molliger Junge mit Brille und kunterbunter, kurzer Hose. Zwischendurch bleibt er mal stehen und schaut den Zille-Mann mit großen Augen an. Und war ein Lied zu Ende, klatscht er begeitstert in seine fleischigen Patschhändchen. Seine Mama sitzt an einem der nahen Tische einer Gaststätte. Sie hat ein hellblaues, bauchfreies T-Shirt und einen schwarzen Minirock an. Sie ist selbstbewußt genug, um zu ihren überquellenden Fettmassen zu stehen. Dabei trinkt sie nur etwas, nämlich leckeren Cappucino. Sie beobachtet ihr Kind, wobei ich manchmal überlege, ob sie nicht doch woanders hinschaut. So arg schielt sie, daß mir ganz schwindlig wird. Nun ruft sie ihren Jungen. Sie drückt ihm etwas in die Hand, als er bei ihr angekommen ist und zeigt auf den Leierkastenmann. Der bekommt von dem Kleinen eine silbern blitzende Münze zugesteckt. Er bedankt sich und nickt lächelnd in Richtung Mutter. Dann bietet er dem Kind an, mal selbst zu spielen. Der Kleine ist nicht feige, sondern versucht es sofort. Er hält nicht den Takt, spielt mal schneller, mal langsamer, und ich flüchte vor dem Katzenjammer. Das blutig-grausige Geschehen mit dem Drachen über ihm interessiert ihn nicht die Bohne.
Dieser fabelhafte Bezirk ist spannend. Hier prickelt das Leben. Wie guter Champagner zergeht er mir genüßlich auf der Zunge. Er entlockt mir immer wieder aufs Neue große, kugelrunde Stauneaugen. Was werde ich noch entdecken?
Das wunderschöne
9
Ahornblatt. Daß es so etwas Angenehmes an dieser Stelle gibt! Dieses Haus wird für mich ein Orientierungspunkt.
Bei der Hütte kriegst du ein Auge! Mitten im Straßenland die
10
Bruchbude, aufgestapelt aus einem heillosen Durcheinander verschiedenster Kisten und Kästen und umgeben von einem gepflegten Gemüsegarten. Und das im Schatten einer erhabenen
11
Kirche. Im Garten arbeitet eine türkische Frau mit bodenlangem, anthrazitfarbenem Rock und einem gleichfarbigen Kopftuch. Zwei Männer sitzen im Schatten des "Hauses" und schwatzen angeregt und laut. Ich verstehe kein Wort. Sie unterhalten sich türkisch.
Ha! Das ist vom Feinsten. So etwas Eigenwilliges! Fenster - nicht gewohnt viereckig, sondern wie die Facetten eines Insektenauges. Magisch zieht mich der
12
Langhansbau der Berliner Wasserwerke an, der je nach Wetter seine Farbe von Blau nach Grau in allen Schattierungen von ganz hell bis dunkel wechselt. Nicht wie ein Chamäleon, das sich der Farbe seiner Umgebung anpaßt, sondern bei Sonnenschein erscheint das Haus im Kontrast zu dem Gute-Laune-Wetter grau und bei Regen wird es blau.
Zwischen den in den letzten dreizehn Jahren neu entstandenen und herausgeputzten Häusern finden sich immer noch Zeitzeugen des 2. Weltkriegs. Außer durch Bomben entstandene Ruinen auch Häuser, die über Straßenkampf berichten mit ihren Hunderten von
13
Einschüssen, die das Mauerwerk zieren.
Beeindruckend das anheimelnde Wärme ausstrahlende
14
Holzhaus mit dem Kreuz, das auf eine schlichte Kirche schließen läßt. Dieses Gebäude prangt auf ehemaligem Niemandsland, der Streifen hinter der Mauer auf der DDR-Seite, der von niemandem betreten werden durfte (außer von patrouillierenden Grenzbewachern). Hier läuft noch originale Mauer entlang, die heute aber nicht mehr die Schrecken von damals vermittelt, als noch dahinter die Stacheldrahtzäune und die Wachttürme mit den schießbereiten Soldaten sowie die Selbstschußanlagen installiert waren.
Mein neuer Bezirk hat viele Gesichter.
Ein
15
Becken für Engel. Wo sind die Himmelsboten? Haben sie sich in kunterbunte Flatterfalter, fleißige Bienchen und dicke, brummende Hummeln, die sich in den wilden Blüten tummeln, verwandelt?
Eigentlich habe ich keine Zeit zum Bummeln. Aber Blicke riskiere ich schon.
Dort erhebt sich das
16
Schwalbenhochhaus, der wahrscheinlich einzige Koloß der Welt in einer Hauptstadt, in das Schadinsekten vernichtende Schwalbenkolonien eingezogen waren. Wahrscheinlich ist das die einzige Hausbesetzung der Welt, die ökologisch sinnvoll, aber ökonomisch nicht tragbar ist.
Ein knallroter Notarztwagen nähert sich mit ohrenbetäubendem Tatü Tata und Blaulicht. Ich bleibe stehen, halte mir mit beiden Händen die Ohren zu und warte, bis er vorbeigeflitzt ist. "Wie wird es wohl dem Mann ergangen sein, der damals bei der Grenzpassage zusammengebrochen ist?" durchzuckt es mich. Ich denke nicht lange an den Fremden. Schon bin ich wieder abgelenkt.
Ich weiß nicht, was ich am besten finde. Immer mehr fällt mir auf:
17
Blaues Geschirr.
18
Holzfiguren. Wertvolle
19
Spitze, handgeklöppelt. Und schön teuer.
20
Filzerei mit wunderlichen und originellen Zipfelhüten.
21
Handweberei mit einem klappernden Webstuhl, der die gute Stube ausfüllt.
22
Bonbonmanufaktur. Bunte, süße Verführungen. Mmh! Lecker!
Mittelalter neben gleißenden, modernen Auslagen. Gegensätze zieh’n sich an.
Ein phantastischer Bezirk!
Hier ist der Bär los!
Ich werde hineingezogen in den Strudel. Und ausgespuckt wie aus einer Windhose. Ich muß die Orientierung wiederfinden.
Mit Herz und Seele verfolge ich nun wieder mein Ziel. Ein Glück! Da ist es! Nur - wo lasse ich mein Auto? Wo kann ich parken? Ich umkreise meinen Kunden. Wie ein Fuchs seine Beute, bereit im richtigen Moment zuzuschnappen. Happs! - Es hilft nichts. Nur ein kilometerlanger Fußmarsch, nachdem das Auto einen Platz in der glühenden Sonne gefunden hat. Viel Zeit und Kraft kostet es mich. Meine hohen Absätze klappern hart übers Straßenpflaster. In der einen Hand schleppe ich die bleischwere Aktentasche, in der anderen die schwergewichtige Tüte mit bunten Schächtelchen für den Kunden.
Urlaubswarm ist es heute. Eine stehende Gluthitze. So schwüle 34 Grad. Im Schatten. Satte Temperatur. Immer neue Rekorde in Berlin; diesmal ein Hitzerekord. Waschechte Saunatemperaturen. Wahrscheinlich wäre es ohne die vielen Bäume in Berlin, die kühlendes Wasser verdunsten, noch heißer. Schatten spenden das Grün Tausender Straßenbäume, die den charmanten Charakter der Metropole Berlin prägen. und die Millionen wärmespeichernden Häuser. Aber nicht überall. Nämlich nicht gerade da, wo ich im Außendienstsauseschritt entlangstürme oder mein Auto parke. Und schon gar nicht hier in diesem Bezirk, wo die Bäume in dem vormals fast kahlen Stadtteil nach der Wende neu gepflanzt wurden. Nun strengen sich diese Babys an, um noch Wer zu werden.
Ich ochse und schwitze wie ein Kümmeltürke in der absolut windstillen Affenhitze, während andere Leute heute baden gehen und sich im Wasser vergnügen. In der Havel oder der Spree, den Flüssen mit ihrem Süßwasser, die gleichgültig gegenüber dem schönen Wetter gemächlich durch Berlin fließen. Anschließend aalen sie sich entspannt auf einem begehrten Schattenplätzchen unter einer mächtigen Eiche oder Buche oder einem anderen wunderbaren Schattenspender, das sie ergattert haben. Oder die Glücklich-Unglücklichen baden in der Sonne.
Ich bade im Schweiß, während die Leute glauben, daß ich spazierengehe. (Vertreter tun nichts anderes, als den lieben, langen Tag mit Spazierengehen zu verbraten). Keine Hand habe ich frei, um mir den triefenden Schweiß im Laufen von der Stirn zu wischen, der wie ein munterer Gebirgsbach unter der Brille entlang der Nase und über die Backen rinnt, um salzig schmeckend in meinen Mund zu tropfen und mir auf die geplagten Schultern zu klopfen. Die langen offenen Haare, meine Löwenmähne, kann ich nicht mehr schütteln. Sie kleben naß auf dem Kopf und dem Hals und wärmen noch zusätzlich wie ein dicker Pelz. Wer Arbeit kennt und danach rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Das bin ich. Eine Verrückte, die sich solchen Strapazen aussetzt. Das kann nur derjenige durchhalten, der seine Arbeit liebt. Die Sonne sagt nichts dazu. Die Sonne meint es gut. Zu gut. Sie lacht dazu freundlich - oder hämisch? - vom wolkenlosen, azurblauen Himmel.
Gemächlichen Schritts kommt mir eine kugelrunde Frau mit einem knallgelbem Kinderschirm entgegen. Den Blick hält die Frau eisern gesenkt, um vielleicht rechtzeitig die Tretminen, diese weißen bis braunen, nicht gefährlich explodierenden, aber rutschigen und klebrigen, manchmal auch erbärmlich stinkenden Hinterlassenschaften unserer geliebten, gassigeführten Vierbeiner - großer und kleiner Hunde verschiedenster Rassen, zu erspähen, denen sie - wie ich - ausweichen möchte. Ich kann sie und ihre Utensilien jedenfalls ungeniert mustern. Ihr Schirm zieht meine Blicke magisch an. Diesen Schirm krönen drei kirschrote Ohren. Umsäumt ist er von neckisch-verspielten Rüschen, die ausgefranst wie viele aneinandergenähte Kasperle-Zipfelmützen herabbaumeln. Dieser aufgespannte Schirm reicht noch nicht einmal über die Schultern der Frau. Bei Regen würde er ihr keinen Schutz bieten, aber der Kopf steckt nicht in der prallen Sonne. Und die Frau?
Diese Frau steckt nicht in einem luftigen, am Körper klebenden zitronengelben Hosenanzug mit passendem, blau-gelbem Top à la schwedischer Flagge wie ich, sondern sie ist kastanienbraun gekleidet. Völlig Ton in Ton. Von Kopf bis Fuß. Auf dem Kopf trägt sie ein kastanienbraunes Kopftuch, über dem braunen, knöchellangen Rock einen langärmeligen Mantel, der bei jedem ihrer weit ausholenden, langsamen Schritte kurz und schnell aufspringt. Was sie für Schuhe trägt, kann ich nicht sehen. Vielleicht weichen die in der Farbe von der Kleidung ab. Aber diese verbirgt den Fußbereich erstklassig. Bis auf den Schirm, der mich noch immer fasziniert, ist diese Türkin eher eine elegante Erscheinung. Türken gibt es eigentlich wie Sand am Meer in Berlin (der Bezirk Kreuzberg wird sogar "Klein-Türkei" genannt), aber in diesem Stadtteil, wo sich die Nationen munter mischen, gehören sie eher zu den Raritäten. Schwitzt diese Frau gar nicht, die fast winterlich dick angepummelt ist? Vielleicht schwitzt diese Türkin nicht so arg wie ich in meinem dünnen Fummel? Wer weiß das? Ich schmunzle ein bißchen. Aber schon bin ich wieder abgelenkt.
Oh! Dort liegt eine Plastiktüte auf der Straße! Ich halte an und stelle meine rückenkrümmende Aktentasche und die Papiertragetasche mit den bunten Schächtelchen ab. Ich nehme ein blütenweißes Taschentuch und wische mir den Schweiß aus dem Gesicht. Obwohl ich frisch gewaschen bin, verwandelte das Tuch seine Farbe in ekliges Rabenschwarz.
An solcher ordinären Plastiktüte läuft jeder achtlos vorüber, wenn er sie nicht gar mit Füßen tritt. Sie kann eigentlich nur das Interesse eines Straßenkehrers wecken. Aber mich zieht sie magisch an. Was ist an so 'ner lumpigen Tüte dran? - Wie wertvoll sie mal war! Plastiktüten! Plastiktüten sollte ich ihnen auch mitbringen. Meinen Ostverwandten. Noch und nöcher. Es konnte nie genug sein. Sie wurden gehegt und gepflegt wie wertvolle, exotische Orchideen. Wahre Kostbarkeiten, die immer wieder nach Gebrauch liebevoll ausgewaschen und getrocknet wurden. Tja... Wie sich die Zeiten ändern! Jetzt werden sie achtlos weggeworfen. Auch im ehemaligen Osten.
Ich hebe die rosafarbene Tüte auf und betrachte sie: Rosa - und sie knistert. Knistertüten hat meine Cousine Edelgard am meisten geliebt. Und rosa war ihre Lieblingsfarbe. Vor allem bei T-Shirts. Diese eitle Dame fand, daß ihr Rosa am besten stand. Vielleicht war es auch ein Omen; denn sie liebte die Männer, und die Männer liebten sie. Sie hatte viele Freunde in West-Berlin, die sie im Schneeballsystem kennengelernt hatte. Der eine kannte den und der wiederum den und der... undsoweiter. So kommt eine ganze Korona zusammen, die sie, als sie zu Besuch bei uns im Westen war, alle abklappern mußte - oder wenigstens die wichtigsten, die reichsten. Sie hatte alle Freiheit. Hier krähte kein Hahn danach, wohin sie ging.
Ja wirklich, meine Lieblingscousine Edelgard durfte auch mal zu mir in den Westen reisen. Kurz vor der Maueröffnung. Im Oktober 89. Wenn dieses Ereignis mein Vater noch erlebt hätte! Wie die Menschen auf die unheilvolle Mauer kletterten, als wäre das das Normalste von der Welt! Ohne die Bedrohung, erschossen zu werden. Und Ost und West miteinander anstießen! Und wie Trabbis durch die Grenzübergänge zu uns in den Westen fuhren! Und Menschen wie Spechte das Monster Mauer kaputt hackten und Bruchstücke als Souvenir aufbewahren! Papa wäre überglücklich gewesen, er, der die Familie zusammenhielt. Er durfte das Unglaubliche nicht erleben; denn kurz zuvor hatte der Sensenmann ihn sich geholt, ihn, der sich von seiner Krankheit nicht hatte einschüchtern lassen und unermüdlich gegen den Krebs kämpfte und mindestens hundert Jahre alt werden wollte. Er war stark abgemagert. Der Tod hat ihn von seinen tierischen Schmerzen befreit.
Trotz aller vernünftiger Gedanken war ich tieftraurig. Nacht umschloß meine Seele ob des Verlustes meines geliebten Vaters. Meine blonde, zierliche Cousine Edelgard mit dem jungenhaft kurzen Haarschnitt durfte, obwohl das Rentenalter noch lange, lange außer Sichtweite war, zur Beerdigung meines Vaters aus der DDR in den Westen ausreisen. Bibi, ihrer Zwillingsschwester mit den schulterlangen, wallenden Locken, wurde die Ausreise ins kapitalistische Ausland BRD (DDR-Jargon), also in die Bundesrepublik Deutschland mit der (provisorischen) Hauptstadt Bonn und nach Westberlin (Ost-Schreibweise) verweigert. Vielleicht hat sie aber auch gar keinen Antrag gestellt. Manche DDR-Bürger hatten unterschrieben, daß sie keinerlei Kontakte zu ihren West-Verwandten pflegen, wenn es ihre berufliche Situation erforderte. Das war dann zum Beispiel der Fall, wenn sie "Geheimnisträger" waren, was immer das heißen mag.
Ich weiß nicht, ob Bibi dazugehörte. Für DDR-Verhältnisse hatte sie allerdings mit 900 (Ost)Mark ein ausgesprochen fürstliches Gehalt. Im allgemeinen betrug die Bandbreite 300 bis 600 Mark. Für die Miete zahlte Bibi 15 Mark, Fahrgeld in öffentlichen Verkehrsmitteln kostete 15 bis 20 Pfennige. Die Lebenshaltungskosten verschlangen anders als im Westen nur wenige Mark. Es gab kaum etwas zu kaufen, was das Herz begehrte. Also konnte das meiste Geld nicht ausgegeben werden und wurde auf die hohe Kante gelegt. Anders als bei uns. Da konnte man mit Mühe und Not einen Notgroschen sparen; denn spare in der Zeit, dann hast du's in der Not.
Was die Lebenshaltungskosten im gesegneten Land Bundesrepublik Deutschland betraf, waren meine Verwandten ziemlich blauäugig. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, daß die Miete schon 700 DM verschlingt, mehr als das durchschnittliche Monatseinkommen in der DDR, das Bruttoeinkommen dadurch im Westen um ein Drittel geschmälert wurde. Dazu kamen Steuern zum Beispiel fürs Auto und auf Lebensmitteln, auf Güter des täglichen Bedarfs, auf alle Konsumgüter, auf nahezu alles. Nur die Luft dürfen wir steuerfrei atmen, was sich meine Ostverwandten nicht vorstellen konnten. Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung - für alles und jedes gibt es eine Zwangsversicherung, deren Beiträge vom Gehalt vor dessen Auszahlung abgezogen werden. Dürfte ich all diese Gelder für Steuern und Abgaben zur Bank tragen, könnte aus mir vielleicht ein Millionär werden. Aber das ist ein anderes Kapitel. Das Fahrgeld mit dem Bus oder U-Bahn kostete 2,40 DM, die Lebenshaltung trotzte ein kleines Vermögen ab. Das Gehaltsniveau war in dem wie eine Insel im DDR-Gebiet liegende West-Berlin etwa 20 Prozent niedriger als im Bundesgebiet, die Lebenshaltungskosten aber wegen der Insellage der Stadt, die von DDR-Gebiet umschlossen war und keine Ausweichmöglichkeit in der näheren Umgebung bot, relativ hoch. Es wurde ein Trostpflaster auf diese Wunde geklebt: die achtprozentige Berlinzulage, die das Einkommensgefälle etwas abfederte, aber nach der Maueröffnung schleunigst abgeschafft wurde. Das Einkommensgefälle blieb. Ja, es wurde sogar durch das Hinzukommen der DDR-Arbeitnehmer - ehemals die "Werktätigen" im Arbeiter- und Bauernstaat - verschärft.
Selbstverständlich durfte Edelgard bei mir wohnen; ich wünschte es mir sogar. Die Vorfreude, meine Cousine bei mir aufnehmen zu können und ihr endlich statt auf Fotos in natura meine Lebensumgebung zu zeigen, zauberte ein bißchen Sonne in mein von schweren Trauerwolken verdunkeltes Gemüt. Edelgard bekam natürlich einen Schlüssel zu meiner Wohnung. So konnte sie unabhängig von mir ein- und ausgehen und ihre zahlreichen West-Bekannten besuchen. Stolze elf Tage durfte sie von Staats wegen bleiben, und sie mußte sich hier nicht anmelden. Blieb ich bei ihr über Nacht, mußte sie mich in ein sogenanntes "Hausbuch" eintragen. Blieb ich mehr als drei Tage oder einer Woche, hätte sie mich bei der Polizei anmelden müssen, obwohl ich nur zu Besuch gekommen war, und das späteste Abreisedatum im Passierschein vermerkt war. In dem mußte ich auch die genaue Adresse angeben von der Person, die ich besuchte. Edelgard vergaß öfters, mich anzumelden, um schwierigen Fragen auf der Arbeitsstelle und einer eventuellen Versetzung vorzubeugen. Sie liebte ihre Arbeit im Theater und in der Möwe in Mitte, wo Künstler ein- und ausgingen. Deshalb mußte ich mein Auto einen Kilometer entfernt von ihrer Wohnung parken, damit der Westbesuch möglichst nicht auffiel. Sie hatte schon Besuch von der Stasi bekommen. Unangemeldet standen sie, diese feinen Herren, eines Tages vor ihrer Tür und begehrten Einlaß. Sie tranken keinen Kaffee, sondern nahmen die Wohnung genauestens unter die Lupe. Edelgard hatte Glück. Ihre Vorsicht hatte sich bezahlt gemacht. Alle Westbücher standen nicht im Bücherregal, sondern in einem Versteck unter den Holzdielen, wo sie immer nach Gebrauch die Bücher wieder sorgfältig verstaute. Sie war nicht scharf darauf, diesen Besuch öfter zu bekommen.
Dann kam endlich der Tag der Beerdigung meines Vaters. Gleichzeitig war dies der Tag der Ankunft von Edelgard. Dann kam sie endlich. Endlich! Nach zig Jahren, wo ich nur zu ihr durfte, konnte endlich sie kommen. (Und wir hatten gedacht, wir müßten bis zum Rentenalter warten). Sie platzte fast vor Neugier, wie es hier im Westen wohl aussieht. Log das West-Fernsehen, wie der Schwarze Kanal seinen DDR-Bürgern unermüdlich in den schillernsten Farben verklickerte?
Endlich sah sie den Westen live, nicht nur im Fernsehen. Sie fand, daß ich reich sei. Sie schloß das aus der Betrachtung meiner alten Möbel, die ich vom Trödel zusammengetragen und eigenhändig aufgearbeitet hatte. Das war eine ganz schön mühevolle und schweißtreibende Arbeit, das Abbeizen der alten Farbschichten. Das Lasieren ging leichter. Meine Cousine Edelgard aus dem Osten ging von einem Bekannten zum anderen im Westen. Jeder Besuch, den sie machte, überzeugte sie davon, daß wir alle im Schlaraffenland leben und einer reicher war als der andere. Der eine hatte ein englisches Teeservice, was ich nicht hatte; der war reicher als ich, denn schöne Möbel hatte er außerdem. Ein anderer besaß Schippendale-Möbel. Der war der reichste. Wer sich solche Möbel leisten konnte, der mußte einfach Millionär sein. Im Westen war einfach alles wertvoller, weil es im Westen war und in Westmark bewertet wurde. Mit für Ostler unvorstellbaren Preisen.
Es war nicht so, daß Edelgard in Bananenkisten lebte. Auch nicht in DDR-Einheitsmöbeln. Nein, sie nannte echte Antiquitäten ihr eigen. Das alte Gerümpel, das über hundert Jahre auf dem Buckel hatte, beispielsweise ein wunderbarer, riesiger Sekretär mit Hunderten Geheimfächern und die verschnörkelten Eichenschränke, die die lederne Couchgarnitur umrahmten, waren alles wertloser Plunder in ihren Augen.
Den Kohl so richtig fett machte ihr Fund meines Sparbuches, auf dem ich ungefähr zwei Monatsgehälter als Notgroschen angespart hatte. Ich hatte schließlich noch eine Tochter zu versorgen und - anders als sie - keinen - die Betonung liegt auf "K" wie k-einen - also keinen sicheren Arbeitsplatz. In ihren Augen waren die etwa viertausend West-Mark ein Riesenvermögen. Devisen! Was man davon im Osten alles bekommen konnte! Sie begriff nicht, daß man im Westen mit der Summe nicht sehr weit kommt, da die Miete, der Kindergarten, die Abgaben und die Ernährung und was weiß ich viel - quasi jeden Pups muß man bezahlen - sehr viel Geld verschlingt und im Handumdrehen draufgeht. Wir hatten zwar solche Errungenschaft wie Arbeitslosenversicherung, die bei Verlust des Arbeitsplatzes einspringt. Wir, die Arbeitslosen im Westen, die wie aussortierte Kleidung ihrer Bestimmung Entrissenen, sie träumten von besseren Zeiten, wo sie wieder arbeiten und schuften dürfen, sie, diese Arbeitslosen bekamen dann Arbeitslosengeld, das etwa sechzig Prozent vom Nettogehalt beträgt (aber nur bis zu einer gewissen Höchstgrenze). Das können sie, unsere Politiker, sich zwar nicht an die Backe nageln, aber im Ernstfall reicht es nicht hinten und nicht vorne. Garantiert ist auf jeden Fall, daß der Lebensstandard sinkt; also: ein Arbeitsplatz ist allemal wertvoller.
Sie hatte mich mit meinem "Vermögen" konfrontiert. In meiner Abwesenheit hatte sie in meiner Wohnung geschnüffelt und das
Sparbuch gefunden. Edelgard, meine Lieblingscousine, mutierte dadurch vom vertrauenswürdigen Menschen zu einem, dem ich nicht auf Teufel komm raus vertrauen konnte. - Nach der Maueröffnung hat sie selbst gemerkt, daß der Betrag nur ein Klacks war. Wie uns allen jetzt beim Euro rann ihr das Westgeld nur so durch die Hände; sie merkte, daß uns nichts geschenkt wurde, sondern wir alles teuer erstehen und unser Geld - das für Ostverhältnisse traumhafte Einkommen in West-Mark - einteilen mußten und nur überlegt ausgeben konnten.
Die rosafarbene Knistertüte warf ich wieder weg. Ich setzte meinen Weg in der himmelschreienden Hitze fort.
Endlich bin ich am Ziel meiner Wünsche! Ich bin beim ersehnten Kunden! Hier ist alles viel schicker als in den ehemaligen Westbezirken. Viele uralte Gebäude, erbaut anno dunnemals mit Stuck und Pomp und anderem Zierrat nicht nur an den Fassaden, wurden schon prächtig aufgemöbelt. Aus den ollen, kaputten Klunkern wurden schillernde, schimmernde Schmuckstücke. Die Kleinode erstrahlen im neuen Glanz. Ach, was! Im taufrischem Glanz. Alles neu macht hier nicht der Mai, sondern die Wende. Von miefig-piefig mausern sich die Ostbezirke zu adretten Stadtbezirken, und dieser Bezirk putzt sich zum Sahnetörtchen unter den Kuchenstücken Berlins heraus. Im Ganzen stellt der ehemalige Ostsektor unter russischer Herrschaft allmählich die Westbezirke Berlins in den Schatten. Im Osten geht die Sonne auf - und im Westen geht sie unter. (Ab und zu gerate ich allerdings noch in Baustellen, Häusern, die saniert werden. Mit Handwerkern, die mit Hämmern und Bohrern einen Höllenlärm fabrizieren. Hier steige ich über abgeklopften Putz. Manchmal ist der Staubnebel auch so dicht, daß ich keine Luft mehr bekomme und mit angehaltener Luft nach oben steige. Wenn die Zeit nicht reicht, halte ich ein blaukariertes Taschentuch vor den Mund und hinterher klopfe ich den schmutzig-weißen Staub aus meiner Kleidung).
Ich melde mich an. Die Dame in der Anmeldung nimmt freundlich meine Visitenkarte entgegen, und ich bin voller Hoffnung, gern gesehen zu sein und bald aufgerufen zu werden. Aber erst einmal heißt es Warten. Das macht mir nichts aus; ich kann nicht erwarten, daß jemand Fremdes alles fallen läßt, um mich zu empfangen. Zwanzig Minuten sind vergangen. Ich stehe mir zwar nicht die Beine in den Bauch, aber ich warte. Ich warte und warte. W a r t e n! Eine halbe Stunde ist noch normal. Ich lese - nicht die Klatschblätter, aus denen nun auch der Osten bestens über königliche Hochzeiten wie die der bürgerlichen Argentinierin Maxima Zorreguieta und dem niederländischen Kronprinzen Willem Alexander, oder über Spekulationen, ob das Paar ein Kind erwartet, und Fehltritte von Prominenten und anderer solcher lebenswichtiger Ereignisse informiert wird, sondern knochentrockene Fachzeitschriften. Die finde ich spannend. Erweitern sie doch meinen Horizont. So wird mir die Zeit nicht lang. Doch nun fällt mir wie aus heiterem Himmel ein, daß es eine Arzneimittelstelle am Flughafen Tempelhof nahe dem Luftbrückendenkmal gab, wo sich Ostrentner, die mit einem Rezept von ihrem heimatlichen DDR-Arzt ausgerüstet waren, kostenlos Arzneimittel holen konnten. Meine Gedanken schweifen ab. Nach damals. Als es noch die Grenze gab. Wie Purzelbäume kullern Erlebnisse in meinen Kopf. Ich lasse meine Lektüre sinken und hänge meinen Gedanken nach.
Einen Kühlschrank hatte ich auch einmal bei uns im Westen gekauft, das heißt, bestellt und bezahlt. Geliefert wurde er über eine bestimmte Handelsorganisation an Edelgard, die dadurch zu so einem Haushaltsgerät der Grundausstattung in wenigen Wochen kam.
Meine Gedanken machen Sprünge wie ein junger Bock. Ich hatte auch mal einen DDR-Bürger kennengelernt, einen Dolmetscher für Schwedisch, der aber niemals sein Land verlassen hat, niemals verlassen durfte, um seine Sprachkenntnisse zu perfektionieren. Er lernte allein aus der Retorte die Sprache. Alle Achtung!
Und nun schlagen meine Gedanken schon wieder einen Haken wie ein Kaninchen auf der Flucht. Mit Edelgard war ich in dem weltoffenen Ungarn und Budapest, wo ich auch West-Bücher kaufen konnte, und in Prag, wo auch die Menschen einen freieren Eindruck als in der DDR machten. Ich hatte mich mit meiner Cousine hinter der DDR-Grenze in der Tschechoslowakei verabredet, von wo aus ich sie mitnahm. Vorher hatte ich schon meiner Tante Irmela in Dresden im Tal der Ahnungslosen (denn sie konnten keinen Westsender empfangen, weder Radio noch Fernsehen) ein Telegramm geschickt, daß ich um 9.38 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof eintreffe. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, die auch aus dem Elbflorenz stammte, dachte, ich komme mit dem Zug und fand sich auf dem Bahnhof ein. Aber die Transitstrecke führte in dem wunderschönen Dresden mit der Brühlschen Terrasse und der Kreuzkirche, wo die Jungen des weltberühmten Kreuzchors ihre traumhaften Stimmen erschallen ließen, wenn sie nicht durch die Welt tourten, genau am Hauptbahnhof vorbei. Und hier hielt ich kurz mit dem Auto an. Die Wiedersehensfreude war riesig, auch wenn ich nicht lange bleiben konnte, da die Transitzeiten protokolliert wurden und plausibel bleiben mußten. - Auf der Rückreise mit Edelgard ließ ich sie einen Kilometer vor der CSSR-DDR-Grenze aussteigen, um sie nach überwundener Grenzpassage wieder im Auto mitzunehmen. Sie hatte große Probleme auf der DDR-Seite. Die Grenzerin filzte sie bis auf die Knochen, weil sie den Autoübergang zu Fuß passierte. Sie wurde genau befragt, mit wem sie gekommen war, und log, daß sich die Balken bogen. Aus der jungen Frau im himmelblauem VW-Käfer wurde ein älterer Mann im erdbraunen Mercedes ist sie gefahren. Außer Sichtweite, vier Kilometer hinter der Grenze mußte
ich zweieinhalb Stunden auf sie warten, bis sie wieder bei mir einsteigen konnte. Es war höchstgefährlich, sie auf der Transitstrecke mitzunehmen. Wenn wir erwischt werden, würde das als Menschenraub und unerlaubte Ausreise gewertet werden. Und das wird beinhart bestraft. Aber ich dachte nicht daran und auch nicht, ob uns vielleicht dann eines Tages ein Rechtsanwalt Vogel gegen Geld von der Bundesregierung auslöst, wenn wir ein Martyrium im Gefängnis hinter uns gehabt hätten. Ich dachte nur daran, daß wir denselben Weg haben, nach Berlin, sie: Ost- ich: West-Berlin. Und sollte ich meine Cousine diesen umständlich bewältigen lassen, während ich bequem mit dem Pkw fuhr? Nein! Nein! Nein!- Ich setzte sie irgendwo auf freier Strecke ab, als sich unsere Wege trennen mußten, denn ich mußte zum Grenzübergang für Transitverkehr und durfte nicht nach Ost-Berlin hineinfahren, und sie wollte nach Hause. Spannung, ob das gut geht.
"Wird sie von einem anderen Autofahrer aufgenommen, sie, die Tramperin? Kommt sie gut nach Hause?" sorgte ich mich. Auf einem Parkplatz sie abzusetzen, war viel zu gefährlich; denn die wurden alle beobachtet. Edelgard bangte, ob ich gut nach Hause gekommen bin. Wehe, wenn ihr Aussteigen beobachtet wurde; dann war ich grausamen Verhören ausgesetzt. Und wie die ausgehen, wußte man nicht.
Schreiben konnte man nicht, denn die Post wurde von der Stasi, dem DDR-Geheimdienst, kontrolliert. Höchstens einen belanglosen Brief mit unverfänglichem Inhalt. Allerdings mußte man bis zu mehrere Monate auf die Post warten. Telefonieren vielleicht? Abgesehen davon, daß es zehn bis zwölf Stunden dauerte, bis eine handvermittelte Verbindung zustande kam, war das viel zu gefährlich. Das Telefon wurde abgehört, und wie schnell sagt man ein "falsches" Wort? Das Sicherste war Warten. Warten, bis ein Verwandter uns wieder mal besuchte. Der konnte dann berichten, wie es dem anderen geht, und man wußte, daß der nicht im Bau, sondern zuhause gelandet ist. -
Apropos...
W - a - r - t - e - n --!! Ich warte lange, aber ich werde und werde noch nicht aufgerufen. Immer noch nicht. Das lange Warten zermürbt. Es zerrt an den Nerven. Langsam werde ich nun doch unruhig. Das überschreitet das Zeitlimit, das ich mir leisten kann. Schon über eine Stunde habe ich gewartet. Endlich die Erlösung! Ich werde aufgerufen: "Frau Laurier!" Komme ich wirklich dran? Das wäre zu schön, um wahr zu sein! Ich jauchze und juble innerlich. Die Befreiung! Endlich bin ich am Ziel, der Kunde zum Greifen nah. Endlich bin ich am Ziel meiner Wünsche. Ich lächel die Anmeldedame glücklich an. Sie sagt mir in freundlich-höflichem Ton: "Ich bedauer außerordentlich. Der Chef ist heute leider nicht zu sprechen. Er hat keine Zeit. Es tut mir leid. Nur mit Termin." Das ist die Krönung! Ihre Worte treffen mich, als hätte sie mir eine schallende Backpfeife verpaßt. Ich kann es nicht fassen. "Was sagt sie da? Was haut sie mir da um die Ohren?" Ich schaue ganz verwirrt drein. Mein Rücken wird ganz rund und die Schultern flutschen nach oben. Ich lasse den Kopf hängen. Eine dunkle Wolke beginnt, meinen Kopf einzuhüllen, durch die wie aus weiter Ferne die Stimme dieser ablehnenden Dame dringt: "Nächstes Mal klappt es bestimmt!" tröstet sie mich, als sie mein bedripstes Gesicht sieht. Ich kann meine Enttäuschung nicht verbergen. In diesem lebenslustigen Bezirk fühle ich mich wie der letzte Dreck. Jawoll! Wie der letzte Dreck fühle ich mich hier. Wie ein geprügelter Hund schleiche ich schlurfenden Schritts von dannen und erkenne: Die Kollegen hatten recht. Sooo recht. Himmelherrgottnochmal! Und wie recht! Verflixt und zugenäht! Wieso klappt das hier so gar nicht? Das hier ist noch eine ganze Ecke schlimmer, als ich mir vorgestellt hatte. Als ich mir vorstellen konnte. (In meinem alten Gebiet ist mir so etwas seit Jahren nicht passiert). Das war nun schon die sechste Absage. Wie lange kann ich das noch durchhalten?
Draußen, umgarnt von heller Sonne, atmete ich tief durch und richtete mich zu voller Frauengröße auf. Ein abgrundtiefer Seufzer rollte aus meiner Brust. "Hilft nichts," sagte ich mir, "dem Kopf hängen zu lassen. Kopf hoch!" ermunterte ich mich. "Das Leben geht weiter. Auf zum nächsten Versuch!"
Als ich mit der beruflichen Tätigkeit als Vertreterin begann, fühlte ich mich wie ein Schmetterling, der von Blüte zu Blüte flattert. Keiner war ich treu, ich ging von einem Kunden zum nächsten und war zu allen nett, und eine Blüte war schöner als die andere und öffnete sich immer prachtvoller, je mehr ich die Blumen, meine Kunden, kennenlernte. - Aber jetzt? Aber jetzt sind die Blüten an dem heißen Sommertag alle knospig-frostig verschlossen.
Und schon trifft mich der nächste Schlag! Unglücklicherweise habe ich in dem Streß vergessen, die Parkquittung zu besorgen. Routineangelegenheit für die Politesse. Kein Erbarmen. Keiner da; Alle Menschen in Blau sind lautlos von der Bildfläche verschwunden, wenn man mit ihnen das schwarze Pech besprechen will. Wie von einem bösen Ungeheuer verschluckt. Sie hinterlassen nur eine einzige Spur: Knöllchen in hoffnungsvollem Grün. Hinter dem Scheibenwischer winkt ein grünes, gefaltetes Zettelchen. Nicht schwer zu erkennen, daß es sich um einen Liebesgruß der Polizei handelt. Sie möchte das Parken mit Sondergebühren bezahlt wissen.
Das bringt das Faß zum Überlaufen und gibt mir den Rest. Diesen Bezirk finde ich kein bißchen mehr springlebendig und ansteckend. Im Gegenteil - ich finde ihn abschreckend und könnte ihn nur so mit den Füßen treten oder kräftig boxen. Aber die Kraft und der Elan haben mich so mir nichts dir nichts verlassen. Die Luft ist raus. Ich habe die Nase gestrichen voll. Ich bin nun matt und zerschlagen. Der Streß schmettert mich für heute nieder. Die meisten Neukunden behandeln mich wie den letzten Dreck. Wie den letzten Dreck behandeln sie mich. Als würden sie nur zu gern auf mich verzichten. Gnadenlos weisen sie mich ab. Nur drei von zwölf Besuchten zeigen Erbarmen. Ich schaffe mein Pensum von acht Kundengesprächen am Tag nicht, obwohl ich mich 10 Stunden und 42 Minuten abrackere. Abrackere für die Katz'. Außendienst ist doch so schön! Immer nur ein Spaziergang! Den ganzen lieben, langen Tag lang. Ob der Vertreterberuf vielleicht auch ein knallharter Knochenjob sein könnte?
An den Umsatz muß ich auch denken. Die Firma erwartet eine Mindestleistung. Umsatz? U - M - S - A - T - Z ? Nach Adam Riese habe ich meinen Umsatz nicht geschafft. Essig Banane. Sprechen wir lieber nicht drüber. - Welch ein Tag! Und das, obwohl ich in meinem alten Gebiet so verwöhnt und immer freundlichst empfangen werde! Gerädert, frustriert und todmüde und frustriert fahre ich nach Hause.
Mir ist nicht ganz die Puste ausgegangen. Ich habe einen langen Atem. Am nächsten Tag spiele ich Stehaufmännchen. Den darauffolgenden Tag das gleiche Spiel. Suchen - den neuen Bezirk erleben und einsaugen - abgewiesen werden. Und wieder und wieder. Und nochmals und nochmals... Keine Grenzen? Ich kann einfach so durchfahren?
Zwei Jahre später: Noch immer verändert mein neues Gebiet fast täglich sein Gesicht. Ganze Straßenzüge sind heute gesperrt, durch die ich gestern noch fahren konnte. Ich habe gelernt, wie ich ausweichen kann und mein Ziel trotz solcher Widrigkeiten erreiche. Übung macht den Meister. Inzwischen liebe ich das neue Gebiet wie mein altes. Ich erobere es Schritt für Schritt. Anders als die meisten anderen Wessis, denen die Grenze und die Verhältnisse in der damaligen DDR noch immer in den Knochen sitzen, daß sie keine zehn Pferde in den Osten, den ehemaligen Unrechtsstaat (wie der Westen die DDR betitelte) kriegen, fahre ich nun auch sonntags privat hin, um die vielen geheimnisvollen und interessanten Ecken kennenzulernen. Es ist ansteckend quirlig hier. Die anfangs hundsgemeinen Kunden sind von ausgesuchter Liebenswürdigkeit. Wie meine langjährigen Kunden in Berlin-Charlottenburg und Berlin-Wedding. Sie benahmen sich auch nicht besser, als ich bei ihnen neu war. Ich habe ihre Tests bestanden. Ich bin wiedergekommen. Trotz anfänglicher Schikanen. Die Neuen erzählen mir aus ihrem früheren Leben. Wie das war zu DDR-Zeiten. DDR schreiben wir heute nicht mehr in Anführungsstrichen,
also nicht mehr als sogenannte DDR. Die unterschiedliche Sozialisation in der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland, die wir niemals BRD genannt haben (das ist reiner DDR-Jargon), ist keine Barriere mehr. Ich bewundere sie, wie sie den abrupten Systemwechsel gemeistert haben. Und nach wie vor empfinde ich es als Wunder, einfach so - ohne Schikanen, ohne Grenzabfertigung - die ehemalige Grenze passieren zu können. Und das nicht nur an bestimmten Stellen, sondern überall in der Stadt. Auch dort, wo ehemals ein Straßenzug quer von der Mauer durchgeschnitten wurde und als Sackgasse endete. An den meisten Stellen merkt man heute gar nicht mehr, wo die Mauer mit ihrem Todesstreifen stand. Nur manchmal ist der Mauerverlauf bewußt gekennzeichnet, beispielsweise mit den Pflastersteinen am Potsdamer Platz und in Berlin-Kreuzberg oder an der Bezirksgrenze von Berlin-Mitte zum Wedding in Höhe der Chausseestraße 92, wo bronzene, liegende, sitzende und springende Kaninchen in einzelne Fußweg- und Straßenplatten in Breite des Mauerstreifens in Erinnerung an die einzigen freien Grenzgänger eingelassen worden waren.
Ich fahre in die Mitte Berlins, Berlin-Mitte, ohne einen Passierschein beantragt zu haben. Zu Mauerzeiten mußte ich einen Passierschein in einem speziellen Passierscheinbüro beantragen. Hier, zum Beispiel im Forum Steglitz an der Schloßstraße, saßen Männer aus der DDR in braunen Uniformen mit unbeweglichen Gesichtern und so gerade, als hätten sie einen Stock im Rücken. Hier galten nicht unsere westlichen Regeln, sondern die, die diese Herren mitgebracht hatten. Die Herren wurden täglich mit einem DDR-Kleinbus zu den Bürozeiten hergebracht und bei Dienstschluß wieder abgeholt. Zurück nach Ost-Berlin. Sie konnten Passierscheinanträge ablehnen. Das galt es zu vermeiden. Niemand wollte unangenehm auffallen. Deshalb ging es hier mucksmäuschenstill und sehr gesittet zu. Jeder folgte peinlichst genau den Anweisungen der Männer. Wir Berliner Antragsteller mußten genauestens angeben, wohin wir reisen wollen und uns peinlichst genau an unsere Angaben halten, um üble Komplikationen, beispielsweise unmenschliche Verhöre oder gar Gefängnis ("das gelbe Elend" - allein der Gedanke an das berühmt-berüchtigte Gefängnis mit den gelben Mauern in Bautzen zaubern mir Gruseln und eine Gänsehaut), zu vermeiden. Meistens beantragte ich nur für "Berlin" (womit Ost-Berlin gemeint war) einen Passierschein. Wollte ich mit meinen Verwandten ein bißchen die DDR erkunden, beantragte ich auch Weimar, die traditionsreiche Stadt der Literatur, Musik und Künste, um auf den Spuren von Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller oder Franz Liszt
zu wandeln. Davon daß die Stadt auch mit anderen großen Namen verbunden ist, mit großen Persönlichkeiten, die dort gewirkt hatten ahnte ich damals noch nichts, obwohl mir Johann Gottfried Herder, Friedrich Nietzsche, Christoph Martin Wieland, Richard Strauß sowie die Künstler des Bauhauses Wassily Kadinski, Paul Klee, Walter Gropius, und Lyonel Feininger schon ein Begriff waren. Vermarktet wurden diese Kulturschätze nicht; man mußte wissen, was man finden wollte. Ebenso erging es Eisenach, Johann Sebastian Bachs Geburtsstadt, um mehr Bekanntschaft mit Martin Luthers Wirken auf der Wartburg zu machen. Jeder andere Ort wurde genauso schamvoll und bescheiden verschwiegen. Wollten wir Ost-Berlin, die Hauptstadt der DDR, bei Erkner verlassen, mußten wir nochmals eine Ausweis- und Passierscheinkontrolle über uns ergehen lassen (auch bei der Rückkunft und manchmal auch unterwegs, wenn wir von der Volkspolizei angehalten wurden), obwohl wir innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik blieben.
Ich lasse die Erinnerungen Erinnerungen sein. Diesmal will ich keine Verwandten besuchen, sondern Kunden. Ich kann die Grenze passieren - ohne Passierschein und ohne Ausweis und ohne Schikanen befürchten zu müssen. Einfach so, auch das schöne, freundliche Umland von Berlin mit seinen stillen, verträumten Landschaften und netten Attraktionen kann ich ganz spontan und ohne Komplikationen besuchen. Jetzt fahre ich vorbei an der verschwundenen
23
Musikbox und der knallroten, futuristisch wirkenden
24
Blechbüchse Infobox. Die gefräßen Kräne, die den fensterlosen Container Stück für Stück abrissen, in dem sich Informationshungrige über die zukünftige Gestalt des Potsdamer Platzes und des Sony-Centers schlaumachen konnten, habe ich eifrig hämmern und bummern gehört. Ich fahre nach Mitte. Über die DDR-Grenze. Die es nicht mehr gibt. Auch in der Erinnerung verblaßt sie mehr und mehr. Vorbei an dem beliebten
25
HyFlyer, der schon von weitem mit seinen leuchtenden Regenbogenfarben freundlichst-fröhlichst grüßt.
Inzwischen ist der Wechsel zwischen den Bezirken ganz selbstverständlich. Ohne Angst und Halluzinationen und nervösem Herzklopfen. Nur die Freude ist noch gegenwärtig.
Dieser schöne Bezirk! Mit dem den
26
Langen Lulatsch überragenden Fernsehturm, der packenden Atmosphäre der Hackeschen Höfe, dem beschaulichen Nikolaiviertel, dem tanzenden und singenden Friedrichstadtpalast, dem anmutigen Historischen Hafen, wo manchmal Oldtimer dampfen und tuten, die urig interessante Museumsinsel, dem protzigen Berliner Dom, dem imposanten Internationalen Handelszentrum mit der niederländischen Botschaft
* und der Sprachenschule und... - Undundund...
Und - den sieht man zuerst nicht, einen der schönsten Plätze der Welt, den
27
Gendarmenmarkt, weil er umsäumt ist von farbenfrohen Reisebussen aus aller Herrgott Länder, aufgereiht wie eine farbenfrohe Elefantenparade, die Touristen auf das historische Pflaster ausspuckt. Ich möchte mich hier im Schatten von Bäumen niederlassen. Die Zierbäume, Zwerg-Akazien mit ihren gefiederten Blättern zum einzelnen Abzupfen und festzustellen: Er liebt mich, er liebt mich nicht... - er liebt mich!, diese Bäumchen sehen wie ein symmetrisch angeordneter grüner Pilzwald aus; denn ihre Kronen gleichen Pilzköpfen. (Aber sie sind nicht unbedingt mit den Beatles zu assoziieren). Ich fühle mich hier pudelwohl.
Leise säuselt der Wind. Die Blätter flüstern, als würden sie über ein sensationelles Ereignis klatschen. Das angenehme Windchen zerzauselt vergnügt meine Haare, als ob er damit wie ein kleines Kind spielt. Wegpusten, loslassen, drin herumwühlen. Und wenn ich sie wieder glattgestrichen habe, wieder mit einem Hauch ein wenig auseinanderfalten. Dann streiche ich es mir wieder aus dem Gesicht.
Dieses lauschige Plätzchen vor dem vornehmen Hilton-Hotel wimmelt nur so von Touristen, die sich ein bißchen von dem Sightseeingstreß erholen. Ihre Fotoapparate
und Filmkameras haben jetzt Pause und zieren die Tische oder die Stuhllehnen.
Zufällig brechen Menschen auf, sodaß ich einen freien Tisch mit zwei Stühlen finde. Anders als früher, als Edelgard ab und zu mit mir in ein Restaurant ging, mußte ich mich nicht an eine lange Schlange Wartender anstellen, um einen Platz zugewiesen zu bekommen, sondern setzte mich dahin, wo es mir gefiel. Ich schaue in die Speisekarte und schwelge in den supertollen Angeboten wie Melonensalat mit mariniertem Krebsfleisch oder Salatvariation mit gebratener Poulardenbrust oder Erdäpfel-Gemüsestrudel mit Schnittlauchsauce, Knuspersalat mit Knoblauchbrot und all' diese phantastischen Gerichte mit ihren phantasievollen Namen. Freundlich, also wirklich reizend und kein bißchen mufflig wie zu DDR-Zeiten (da bedeutete jeder Gast Arbeit und störte die Ruhe; denn sein Gehalt bekam man auch ohne Gäste), also - hier und jetzt ist das anders, hier spricht mich eine hübsche Kellnerin an und fragt nach meinen Wünschen.
Ich bestelle mir - und mir läuft schon bei dem bloßen Gedanken daran das Wasser im Mund zusammen - ein schnödes, leckeres Eis mit Schlagsahne, deren Weichheit und Feinheit den Gaumen streichelt, und eine Tasse aromatisch duftenden Kaffee und genieße den Platz. Die junge Frau strahlt mich an, als hätte ich die größte Bestellung der Welt aufgegeben und macht mir mit diesem Verhalten Appetit auf mehr.
Leute zu betrachten und beobachten, macht Spaß. Andere brauchen dazu eine Zigarette. Ich nicht. Wenn man hier so sitzt, dann sind die anderen Leute die Affen, die man beobachtet. Wie im Zoo im Freigehege. Das denke ich natürlich nicht, sondern schaue mich nur von meinem festen Standpunkt, dem Sitzplatz an einem anheimelnden Platz, um. Nicht nur die Flaneure, die sich hier aus der ganzen Welt zusammenfinden, Deutsche, Europäer, Japaner und Amerikaner, die ich teilweise an ihrer Sprache oder ihrem Habitus erkenne, interessieren mich, sondern auch die Umsitzenden. Ich schaue sie an. Am Nachbartisch sitzt offenbar ein Ehepaar. Neben der Frau in lindgrünem T-Shirt und Blue-Jeans steht ein Kinderwagen. Unter dem rot-weißen Sonnenschirmchen, das an der Lenkstange befestigt ist, liegt ein kahlköpfiger Säugling. Das Baby trägt einen hellblauen Strampler mit abgeschnittenen Beinen, mehr nicht. Es hat die Augen geschlossen und schnieft ab und zu zufrieden im Schlaf. Manchmal huscht sogar ein kleines Lächeln über sein Gesichtchen, wobei sich ein Grübchen in die linke Wange gräbt. Es träumt sicherlich von angenehmen Dingen. Vielleicht davon, wie seine Mama es stillt? Das runde Eierköpfchen ist leicht zur Seite in Richtung zu dem Stoffpüppchen, das mit seinen roten Zöpfen und den Ringelstrümpfen an Pipi Langstrumpf erinnert, geneigt. Die Händchen hat es behaglich vor dem Bäuchlein gefaltet. Die strohblonden Eltern beobachten es glücklich.
Mein Blick läßt die Familie los und schweift umher. Ein Mann von stattlicher Statur, mindestens zwei Meter groß und bestimmt einem Meter breiten Schultern, wodurch der Mann viereckig wirkt. flaniert mit einem gigantisch großen, weißen Schäferhund, einem Prachtexemplar, einem Berber von einem Hund, vorbei. Der Amerikanisch-Kanadische Schäferhund ist bei uns eine absolute Rarität. Ich folge ihm mit den Augen. Auch sein Herrchen ist eine seltene und etwas seltsame Erscheinung. Er trägt über dem nackten, gebräunten Oberkörper eine schwarze Weste, die sicherlich nur mit einem langen Bindfaden zu schließen geht; denn der Bauch des Mannes ist doch schon ein gewaltiger Mollenfriedhof und wölbt sich wie bei einer Schwangeren mit Zwillingen im neunten Monat über den Hosenbund in die Welt. Den Stoff der Weste kann man allerdings unter den blinkenden und blitzenden Orden, mit denen er gepflastert ist, kaum erkennen. Dazu trägt der Mann kurze Hosen. Die gebräunten, kräftigen Stachelbeerbeine stecken bei dieser Wärme praktischerweise mit nackten Füßen in Jesussandalen. Der Mann trägt seine langen Haare nicht wie ich offen, sondern hat sie in einem polangen Pferdeschwanz gebändigt. Er trägt einen Zickenbart. Seine Haartracht umrahmt das Gesicht wie ein Heiligenschein, durch den der in der Mitte kahle Schädel ein wenig drüberlugt.
Ein fuchsroter Azawakh mit weißen Vorderläufen und weißer Brust, ein afrikanischer Windhund afro-asiatischer Art, trabt hoch erhobenen Kopfes herbei. Der hochläufige und elegante Hund, der wie von hohem Adel wirkt, kläfft aufgeregt wie ein Giftzwerg und wedelt mit dem Schwanz hin und her wie mit einem Staubwedel ohne Quaste, mit dem er winkt. Er stört mit seinem Gebell die anheimelnde Ruhe, die nur selten von vorbeihetzenden Knatterautos unterbrochen wird. Er sucht unter dem Bauch von dem Großen und Starken, dem weißen Kumpel, irgendetwas: Er oder sie? - (der Schäferhund ist auf jeden Fall ein Rüde) - schnüffelt ganz aufgeregt. Der würdig ruhig stehengebliebene Schäferhund, der Starke, der dem Eleganten mit einem kurzen, freundlichen, dunklen "Wuff" antwortet und der nun "Carlo" mit einer unerwarteten, hohen Fistelstimme von diesem kräftigen, großen Herrchen gerufen wurde, daß mir die Ohren wackeln, schaut interessiert zu dem Prestigeträchtigen. Der hält seinen Schwanz steil aufgerichtet, wedelt und riecht ein bißchen an dem aufgeregten Artgenossen. Inzwischen kommt sein Frauchen dazu, eine zierliche, kleine Frau, dünn wie eine Bohnenstange, in einem schicken rosafarbenen Kostüm. Mich durchzuckt ein Gedankenblitz. Ich denke sofort an meine Cousine Edelgard. Aber sie ist es nicht.
Der Frau scheint die Angelegenheit peinlich zu sein, und sie knurrt sozusagen und pfeift nach ihrem Liebling, um ihn zu sich zu locken. Der hört gehorsam, hatte aber irgendwie die Orientierung verloren und rennt in meine Richtung. Der Kumpel und die Adlige sind getrennt. Der Windhund guckt sich noch öfters nach dem Hunderiesen, seinem interessanten Artgenossen, um. Aber diese Beziehung ist zum Untergang verurteilt. Fast wie die Titanic. Inzwischen ist der Schönling auf Grund gelaufen. Er ist bei mit angekommen und springt mich schwanzwedelnd an. Er wuselt mit seiner spitzen Schnauze an meinem herunterhängenden Rock herum und folgt von dessem Saum den aufgedruckten Blumen und Schmetterlingen nach oben. Dann ist er mit seiner aufgeregten Schnauze in meinem Schoß angekommen, was mir Grauen einflößt. Sollte ich ihn wegjagen? Beißt er? Schreckliche Lage, in der ich mich befinde. Ich will ihn abwehren, aber auch nicht anfassen. Dann hätte ich
- wenn er mich nicht gebissen hat - unbedingt das Bedürfnis, mir die Hände zu waschen. Ich sitze in der Zwickmühle. Ich suche eine Entscheidung. Ich rühre mich nicht. Ich habe nur Augen und Ohren für diesen Hund. Da nähert sich mir eine Hand. Ich zucke erschreckt zusammen. Was hat diese Hand mit mir vor? Diese greift...
nicht nach mir, sondern nach dem Hund. Die elegante Dame hat mich etwas ungehobelt aus meiner mißlichen Lage befreit und brabbelt etwas knapp, was ich als Entschuldigung auffasse. Sofort ist sie verschwunden, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen. Der Schreck sitzt mir in den Gliedern und kommt jetzt raus. Ich zittere etwas.
Aber schon bin ich wieder abgelenkt. Hier gibt es viel zu gucken.
Ich zittere immer noch etwas, als ein Mann meinen Blick fesselt. Er ist ein älterer Mann, ein grauhaariger Krauskopf, der eben noch den Deutschen Dom vor mir fotografiert hat und sich nun nach einem Platz umschaut. Der Mann ist nicht schön, aber er hat was. Er sieht interessant aus. "Den kenne ich," schießt es mir durch den Kopf. "Aber woher??" frage ich mich angestrengt, lege meine Stirn in Falten und grübel. Ich kann ihn nicht gleich einordnen.
Die Spatzen hüpfen zwischen den Stühlen und schnappen sich heruntergefallene Brotkrumen. Ab und zu stimmen sie ein Zeter und Mordio an, zanken tschilpend, sich eindruckweckend aufplusternd, um die schönsten Krümel, und versuchen, sie sich gegenseitig abzujagen. Ich beobachte die herzverzaubernden Gesellen nur aus den Augenwinkeln.
Der Mann! Den behalte ich im Auge. "WER ist das wohl?" Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Er trägt einen silbergrauen Anzug und passende Schuhe. Dazu einen taubenblauem Schlips mit klitzekleinen, silbernen Sternchen. Man könnte ihn für einen Künstler halten. Da steuert dieser Mann meinen Tisch mit dem einzigen, freien Stuhl an. Und er tut etwas, was für deutsche Verhältnisse sensationell ist: Er fragt mich: "Ist dieser Platz noch frei?" und setzt sich zu mir, als ich mit dem Kopf nicke.
Von seiner vollen, warmen - ja gutturalen Stimme bin ich sofort verzaubert. Sie perlt durch meine Ohren. Sie läßt Saiten in mir schwingen und klingen. Sie scheint nicht nur mein Herz anzustoßen, sondern auch mein Gehirn anzuschubsen und ihm auf die Sprünge zu helfen.
Bisher fiel der Groschen nur pfennigweise, aber nun fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Vor meinen Augen erscheint das Bild der Grenzanlagen. Der hübsche Grenzer. Ich steige aus und mühe mich, meine Angst zu beherrschen. In der Nebenreihe steht ein schicker Jaguar mit einem eleganten Herrn mit grauen Schläfen. Der sackt plötzlich zusammen. Der Notarzt eilt herbei. Er hat ihn gerettet! Das ist der Mann!
Er, kaum größer als ich, die 1,69 Meter mißt, hat jetzt zwar schlohweiße Haare und auch einige Falten im Gesicht; vielleicht ist er siebenundfünfzig Jahre alt oder etwas älter. Ich kann so schlecht schätzen. Nur mein Alter weiß ich genau, zweiundvierzig Lenze kann ich schon auf die Waagschale der Lebenswaage legen. Aber das ist er, der feine Pinkel mit dem Jaguar. Die tiefliegenden Augen, das energisch vorspringende Kinn, die Hakennase, kein Bild von einem Mann (aber er hatte 'was, das sogenannte Etwas) - ja, kein Zweifel, das ist er. Ich bin mir hundertprozentig sicher.
Ich lächle ihn an. Ich, die ein weißes Kleid mit knallroten, romantischen Rosen und den orangefarbenen Feuerlilien und der blauen Iris und den bunten, einheimischen Schmetterlingen anhabe, mein Lieblingskleid, ein feenhaftes, seidiges Gedicht mit weit schwingendem Rock und hautengem Oberteil, das mir gut steht. Die Falter sind heimisch wie die Pflanzen. Aber sie bleiben nicht still an einem Ort stehen und warten auf ihre Bewunderer, sondern gaukeln von Blüte zu Blüte. Hummelschwärmer mit ihrem samtigen, dottergelben Körper und den durchsichtigen, rotgeränderten Flügeln zieren nicht mein Kleid. Auch nicht das rote Ordensband, das unter dem unscheinbaren, braunen Rock prachtvolle rot-schwarz gebänderte Flügel verbirgt. Die bunten Hinterflügel zeigt dieser Schmetterling nur, wenn er die Flügel ausbreitet. Das macht er manchmal, um einen Angreifer zu erschrecken. Das Landkärtchen, dessen orange Flügel mit schwarzen und weißen Flecken wie eine Landkarte wirken, ziert auch nicht mein Kleid. Und ebenso nicht die Wanderfalter Admiral und Distelfalter, die uns jedes Jahr wie die Zugvögel verlassen und in Afrika überwintern, um im Frühjahr wieder zu uns zu kommen und sich fortzupflanzen. Also, die haben alle keine Gnade bei dem Designer meines Kleides gefunden.
Aber der Silbergrüne Bläuling (natürlich das prächtig blaue Männchen und nicht das unscheinbarere braune Weibchen) und der herrliche Dukatenfalter mit den orangeroten, schwarz geränderten Flügeln. Auch der aparte, gelb-schwarze Schwalbenschwanz trägt zur Schönheit meines Kleides bei. Die Falterlinge schmücken mein Kleid farbenfroh wie das schöne Federkleid einen bunten Papagei. Dazu trage ich rote Pumps.
Dieser Mann, der dem Tod von der Schippe gehoppst zu sein schien, verbeugt sich nun halb dankend, halb grüßend und setzt sich zu mir und lächelt zurück. "Er hat nicht nur gute Umgangsformen, sondern ist auch charmant," stelle ich schnell fest.
Der Wind spielt immer noch mit meinen Haaren Dieser wildfremde Mann spielt mit meinen Augen. Sie antworten scheu. Er beginnt ein Gespräch. Da hier meistens Touristen sitzen, fragt er mich: "Woher kommen Sie?" Diese Stimme! Was für eine Stimme! Dieser Stimme könnte ich immerzu lauschen, lauschen, nur lauschen. Sie zieht mich in ihren Bann. Die anderen Menschen um uns herum versinken ins Nichts. Sie sind nicht mehr da. Jedenfalls nicht für mich. Ich habe nur Augen und Ohren für IHN. Ich höre meine Stimme wie aus weiter Ferne, die antwortet: "Aus Steglitz," antworte ich.
Hier treffen sich Menschen aus aller Welt; aber an diesem Tisch nun ausgerechnet zwei Berliner, wie er bald feststellt. Er kommt aus Nikolassee, aus der Gegend der - noblen und idyllischen - Rehwiese und ist ebenfalls fasziniert von diesem Bezirk. Ich frage ihn, was er hier macht. Er ist oft hier in Mitte und gern. Er fährt oft hierher, um den Bezirk genauer kennenzulernen, denn Ost-Berlin war außerhalb unserer Verwandtenbesuche weitestgehend für uns Westberliner ein böhmisches Dorf. Zum Schluß stellt er sich sogar vor. "Siegfried von Engel heiße ich."
Ich erfahre auch seinen Beruf. Er ist kein Künstler, und doch ist er Künstler. Er ist Neurochirurg und beschäftigt sich mit komplizierten Operationen. Da muß er doch - mehr noch als ein Künstler - goldene Hände haben. Mir fällt meine Handtasche zu Boden. Augenblicklich bückt er sich und gibt sie mir zurück. Gleich anschließend ist er schon wieder unterm Tisch verschwunden. Nanu? Ist er umgefallen? Wie damals an der Grenze? Ich schaue etwas ängstlich unter den Tisch. Er fummelt einen festen Knoten in seinen Schnürsenkeln auseinander. Ich bewundere
seine ausgesprochen geschickten Finger.
Als er wieder überm Tisch auftaucht, frage ich ihn, ob er mal an der Grenze zusammengebrochen war. "Ja, an der Sonnenallee," erinnert er sich. "Da schien die Sonne zu arg. In der mörderischen Hitze hatte ich einen Kreislaufkollaps bekommen. - Ich kam bald wieder zu mir. Der Arzt hatte den Knoten von meinem Schlips gelockert, den oberen Hemdknopf geöffnet und einer der Soldaten hielt meine Beine hoch." lächelt er vergnügt bei den Gedanken an die damalige Aufregung. "Also hatte er damals keinen Herzinfarkt. "Wie man sich irren kann!" denke ich und erzähle ihm von meinen Spekulationen und Befürchtungen. Er mußte hellauf lachen, und der Schall perlte aus seinem Mund. Was die Leute gleich phantasieren! Er war auch immer angespannt, wenn er die Grenzanlagen passierte, obwohl er total unschuldig und bieder war und nichts, aber auch absolut nichts Riskantes tat. So plauderten wir weiter und kamen von Hölzchen auf Stöckchen. Wir verstanden uns bestens und verabredeten einen gemeinsamen Ausflug in Mitte.
"Püppchen, du bist mein Augenstern, Püppchen, ich hab' dich zum Fressen gern!" summe ich glücklich vor mich hin, als ich nach Hause fahre. Und meine Gedanken schweifen zu meinen neuen Freunden, die ich inzwischen auch in den neuen Bundesländern gefunden habe, wie nun die Bundesländer der ehemaligen DDR genannt werden. Sie sind mit dem anderen System aufgewachsen, und ich habe sie lieben und schätzen gelernt. "So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der sollte nie vergeh'n!"
...
Und was lieben Sie?
Angelika Paul
Hier werden die kleinen Geheimnisse der Geschichte gelüftet
Zurück zum Seitenanfang
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen:
 mail
mail